Geothermie kann beständige Wärme liefern, bleibt aber teurer in der Errichtung als Solarstrom. In vielen Fällen sind die Kosten für Wärme aus tiefen geothermischen Quellen vergleichbar mit fossilem Gas, während Solar-PV-Strom bereits deutlich günstigere Strompreise erreicht. Geothermie bietet dafür konstante Leistung und geringe Fluktuation und kann für Fernwärme oder industriellen Prozesswärmebedarf wichtig sein. Die Abwägung zwischen Investitionsrisiko und langfristiger Versorgungssicherheit ist zentral für die Planung und Politik.
Einleitung
Wenn Strom aus Photovoltaik heute oft zu sehr niedrigen Preisen angeboten wird, stellt sich die Frage: Warum gilt das nicht automatisch auch für Erdwärme? Die Antworten liegen in Unterschieden bei Technik, Risiko und wo die Energie gebraucht wird. Solarstrom wird in großen Stückzahlen gebaut, Module profitieren von weltweiten Skaleneffekten. Tiefengeothermie dagegen braucht oft teure Bohrungen, lokale geologische Daten und längere Planungszeiten. Für Haushalte oder Städte bedeutet das: Solar erleichtert kurzfristig den Zugang zu günstigem Strom, Geothermie kann langfristig Grundlast für Wärme liefern — aber zu anderen Kosten- und Risikoprofilen.
Geothermie: Grundlagen und Kostenherkunft
Geothermie nutzt Wärme aus dem Untergrund. Dabei wird zwischen oberflächennahem Einsatz (Wärme für einzelne Gebäude) und tiefer Geothermie unterschieden. Tiefe oder hydrothermale Geothermie fördert heißes Wasser aus Hunderten bis Tausenden Metern Tiefe. Diese Anlagen haben hohe Erstinvestitionen: Bohrungen, Thermalpumpen, Wärmetauscher und Anschluss an ein Wärmenetz. Die größten Kostenposten sind oft die Explorationsbohrungen und das Risiko, dass die vermutete Wärmequelle nicht in der erwarteten Qualität gefunden wird.
Geothermie liefert gleichmäßige Wärme, doch die Anfangskosten und das Explorationsrisiko prägen die Wirtschaftlichkeit.
Messgrößen wie der Levelized Cost of Heat (LCOH) fassen Investition, Betrieb und Finanzierung über die Lebensdauer zusammen. In deutschen Studien werden für Tiefengeothermie häufig Werte um 25–40 EUR/MWh genannt, das sind etwa 2,5–4,0 ct/kWh, wenn man die Einheit umrechnet. Für Stromgewinnung aus Tiefer Geothermie liegen globale LCOE-Schätzungen oft höher, im Bereich um 7 ct/kWh oder mehr — hier spielen kleine Anlagengrößen und lokale Bedingungen eine Rolle. Das macht den direkten Kostenvergleich mit Solar komplex: Solar misst man als Strom, Geothermie liefert oft Wärme.
Wenn Zahlen älterer Studien genutzt werden, ist Vorsicht geboten. So stammt eine umfassende Roadmap zur tiefen Geothermie aus dem Jahr 2022; diese ist damit älter als zwei Jahre und bleibt wegen technischer Annahmen und geologischer Daten interpretativ. Aktuelle Positionspapiere aus 2024 aktualisieren viele Annahmen, verlangen aber ebenfalls nach regionalen Prüfungen.
Wenn Zahlen oder Vergleiche tabellarisch helfen, zeigt die folgende Darstellung die Größenordnung:
| Merkmal | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Tiefe Geothermie (Wärme) | Levelized Cost of Heat, grobe Spanne | 25–40 EUR/MWh (2,5–4,0 ct/kWh) |
| Photovoltaik (Freifläche) | LCOE für Utility-PV in Deutschland 2024 | 4,1–5,0 ct/kWh |
| Photovoltaik (Dach) | LCOE abhängig von Größe und Eigenverbrauch | 6–14 ct/kWh (kleine Anlagen) |
Solar vs. Geothermie: Wie die Zahlen im Alltag wirken
Für eine Stadt mit Wärmenetz sieht die Rechnung anders aus als für einen Hausbesitzer mit Dachfläche. Solarstrom ist besonders günstig, wenn er großflächig und dort erzeugt wird, wo Sonne scheint. Fraunhofer-Daten zeigen für Freiflächen-PV 2024 LCOE in Deutschland um 4,1–5,0 ct/kWh. Das macht Solar zur preiswerten Option für Strom, vor allem wenn der Marktpreis für Strom steigt oder Netze ausgebaut werden.
Geothermie punktet als verlässliche Wärmequelle. In einem Fernwärmeverbund kann tiefe Geothermie Spitzenlasten reduzieren und konstantere Preise bieten. Für industrielle Anwendungen, die konstante Prozesswärme benötigen, ist Geothermie oft wirtschaftlich attraktiver als strombetriebene Wärmepumpen, besonders wenn große Mengen Wärme benötigt werden. Die Investitionen sind hoch, amortisieren sich aber über Jahrzehnte.
Betrachtet man Kosten pro Kilowattstunde, zeigt sich: Solarstrom ist in vielen Fällen günstiger als Strom aus geothermischen Anlagen. Für Wärme liegt tiefe Geothermie jedoch in einer vergleichbaren Größenordnung wie alternative Wärmelieferungen und kann teils günstiger sein als langfristig teurer werdende fossile Optionen. Das erklärt, warum Planer Solar für Stromprioritäten sehen, während Geothermie in Wärmenetzen als stabilisierender Baustein gilt.
Chancen und Spannungsfelder
Das größte technische Potenzial der tiefen Geothermie in Deutschland wird von einigen Studien auf rund 300 TWh pro Jahr geschätzt. Das wäre ein signifikanter Beitrag zur Wärmewende. Der Einstieg hakt jedoch an mehreren Punkten: Erstens am Explorationsrisiko. Bohrungen sind teuer, und ein Fehlschlag belastet das Projekt. Zweitens an regulatorischen und genehmigungsrechtlichen Fragen: Schutz von Grundwasser und Vermeidung von seismischen Effekten sind nötig und erklären längere Vorlaufzeiten.
Finanziell entstehen spezielle Herausforderungen: Banken zögern bei Projekten mit Unsicherheit über Fündigkeit. Deshalb fordern Fachverbände und Umweltorganisationen Risikofonds oder staatliche Absicherungen. Solche Instrumente könnten private Investitionen anziehen, ohne dass der Staat dauerhaft Subventionen zahlt.
Akzeptanz in der Bevölkerung ist ein weiterer Punkt. Bohraktivitäten und mögliche lokale Erschütterungen erzeugen Aufmerksamkeit. Transparente Kommunikation, geeignete Standards für Umweltschutz und Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene helfen, Konflikte zu vermindern. Gleichzeitig sorgen niedrige LCOE bei Solar dafür, dass der politische und wirtschaftliche Druck steigt, dort zuerst zu investieren, wo schnelle Erfolge möglich sind.
Blick nach vorn: Kombinationen und Politik
Langfristig ist keine einzelne Technologie ausreichend. Ein pragmatischer Ansatz verbindet Solar, Wind, Speicher und an passenden Standorten Geothermie. Geothermie eignet sich besonders dort, wo Wärmenetze dicht sind oder Industrie konstant Wärme benötigt. Solar trägt kurzfristig zur Strompreisreduktion bei und senkt die Betriebskosten elektrischer Wärmepumpen.
Politische Maßnahmen können helfen, das Explorationsrisiko zu reduzieren: staatliche Fonds, geologische Datenbanken und beschleunigte Genehmigungsverfahren sind häufig genannte Instrumente. Ein Beispiel: Forderungen aus 2024 schlagen vor, ein Risikofonds aufzubauen und geologische Informationen bundesweit zugänglich zu machen, um Planungskosten zu senken.
Wichtig ist, dass historische Studien nicht einfach eins zu eins übernommen werden. Die Roadmap zur tiefen Geothermie von 2022 liefert nützliche technische Annahmen, doch sie ist älter als zwei Jahre und sollte zusammen mit aktuellen 2024-Analysen bewertet werden. Dynamik in Preisen und Technik, insbesondere bei Photovoltaik, kann die wirtschaftliche Gewichtung verschieben. Für Städte und Regionen heißt das: lokale Potentialprüfung, kombinierte Planung mit PV und Speicher sowie abgestimmte Förderinstrumente reduzieren Risiken und steigern den Nutzen.
Fazit
Geothermie ist keine günstige Sofortlösung wie Solar-PV, liefert dafür aber verlässliche Wärme über Jahrzehnte. Die höheren Anfangskosten und das Explorationsrisiko erklären, warum Geothermiepreisangaben nicht so stark fallen wie Solarpreise. Gleichzeitig bietet Geothermie für Wärmenetze und Industrie einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung, weil sie unabhängig von Tages- und Jahreszeit grundlastfähige Wärme liefert. Für die nächsten Jahre ist eine kombinierte Strategie sinnvoll: Solar und Speicher dort ausbauen, wo Strom preisgünstig und schnell skalierbar ist, und Geothermie gezielt dort fördern, wo dauerhafte Wärme und Netzintegration den größten Nutzen bringen.
Wenn Sie Gedanken oder Erfahrungen zur lokalen Wärmewende haben: Teilen Sie diese gern und diskutieren Sie mit anderen Lesenden.


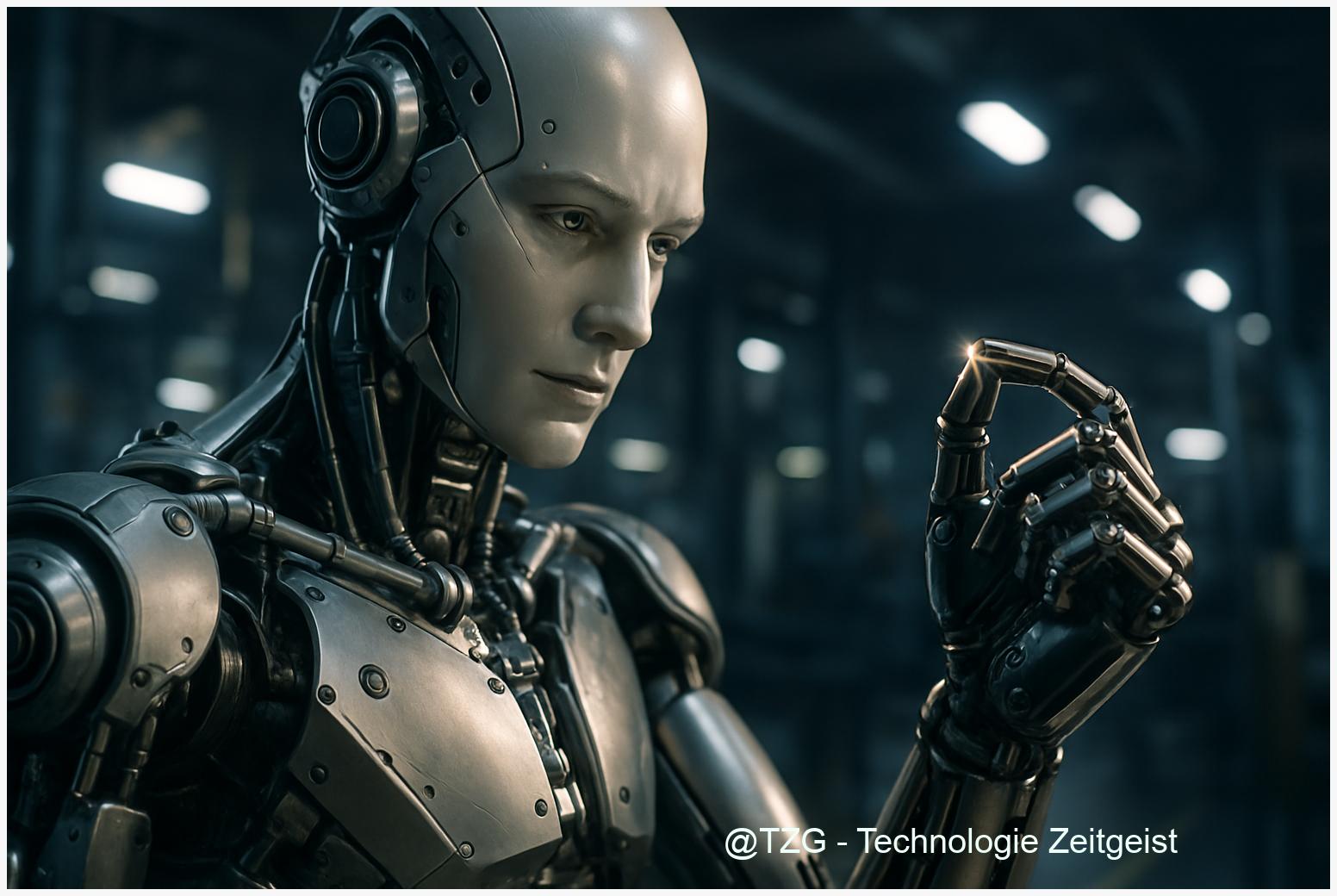

Schreibe einen Kommentar