Kurzfassung
Tesla will die FSD‑Zulassung in Europa über das sogenannte Verfahren nach „Artikel 39“ vorantreiben. Hinter dem Schlagwort steckt kein einzelnes EU‑Gesetz, sondern Prozesse im UNECE‑System (WP.29) zur internationalen Typgenehmigung. Zuständig sind UN‑Gremien für Regeln und nationale Behörden für Prüfungen. Offiziell bestätigte Details zur konkreten Einreichung sind rar, doch die Weichenstellungen laufen. Was das für Fahrerinnen und Fahrer bedeutet, welche Hürden bestehen und wie die nächsten Schritte aussehen, ordnen wir kompakt und verständlich ein.
Einleitung
Tesla rückt näher an die FSD‑Zulassung in Europa – so zumindest der Tenor in der Branche. Von „Artikel 39“ ist oft die Rede, wenn es um den Weg durch die internationalen Regeln geht. Klingt technisch, ist aber vor allem: ein Koordinationsspiel. Zwischen UN‑Gremien, EU‑Vorgaben und nationalen Prüfstellen. Für uns alle stellt sich die Frage: Wird autonomes Fahren bald Alltag – oder bleibt es vorerst ein Versprechen? Wir holen die Begriffswolke vom Himmel auf die Straße.
Artikel 39 entwirrt: Was wirklich dahintersteckt
Was ist „Artikel 39“ eigentlich? Der Begriff taucht in Berichten rund um Teslas Pläne regelmäßig auf, ist aber kein offizieller, alleinstehender EU‑Paragraf. In der Praxis dient er als Kurzformel für Wege über das UN‑System der Fahrzeugregulierung (UNECE/WP.29). Dort werden internationale Regeln entworfen, die Länder später übernehmen. Wichtig: „Artikel 39“ ist je nach Vertrag etwas anderes. Ohne Kontext bleibt er missverständlich – deshalb lohnt der Blick in die Primärdokumente.
„Der Weg zur Genehmigung führt über UN‑Regelwerke und nationale Prüfungen – ein Sprint ist das nicht, eher ein Staffellauf.“
Hinter den Kulissen arbeiten mehrere Arbeitsgruppen: FRAV legt Sicherheitsziele fest, VMAD kümmert sich um Prüfmethoden. Parallel regeln bestehende UN‑Vorschriften Cybersecurity und Software‑Updates. Aus diesen Bausteinen entsteht der Rahmen, in dem auch Teslas Full Self‑Driving bewertet werden soll. Eine formale, öffentlich einsehbare Bestätigung einer konkreten Tesla‑Einreichung ist begrenzt verfügbar; Branchenberichte deuten das Vorhaben jedoch an.
Zur Einordnung der oft zitierten Abkürzungen hilft eine kleine Orientierung:
| Kürzel | Rolle im Prozess | Status 2025 |
|---|---|---|
| WP.29/GRVA | UN‑Gremien entwickeln Regeln für automatisiertes Fahren | Laufende Arbeit an ADS‑Rahmen |
| FRAV/VMAD | Sicherheitsziele und Prüfmethoden | Spezifikationen werden verfeinert |
| UN R155/R156 | Cybersecurity & OTA‑Updates | Bereits in Kraft |
Wer entscheidet? UNECE, EU und nationale Behörden
Damit FSD legal fährt, müssen mehrere Zahnräder greifen. Erstens die UNECE‑Ebene: Hier entstehen die technischen Regeltexte. Zweitens die EU‑Ebene: Die Union übernimmt UN‑Regeln und ergänzt sie mit eigenen Pflichten, etwa zur Typgenehmigung. Drittens die nationalen Behörden, die Fahrzeuge prüfen und Genehmigungen erteilen. In Europa sind das z. B. KBA (Deutschland) oder RDW (Niederlande). Ohne das Zusammenspiel bleibt eine FSD‑Zulassung in Europa Stückwerk.
UNECE‑Dokumente zeigen, wie intensiv an den Grundlagen gearbeitet wird. Sicherheitsanforderungen, Testkataloge, Datenaufzeichnung – alles Themen, die für autonome Fahrfunktionen entscheidend sind. Gleichzeitig gilt: Ein UN‑Dokument allein macht noch keine europäische Betriebserlaubnis. Die EU muss die Vorgaben aufnehmen, und nationale Stellen müssen sie anwenden. Dieser Stufenbau schützt am Ende uns alle im Verkehr.
Spannend wird es bei der Frage, wo Tesla den Antrag konkret stellt. Denkbar ist der Weg über eine nationale Typgenehmigungsbehörde, die auf Basis der UN‑Regeln prüft. Das Ergebnis kann dann – je nach Regelungsstand – international anerkannt werden. Branchenberichte verorten Teslas Ambitionen genau hier. Offizielle Registereinträge sind öffentlich jedoch nur begrenzt sichtbar. Daher lohnt der Blick in Sitzungsprotokolle und Beschlüsse der Gremien, um Fortschritte zu erkennen.
Für dich heißt das: Wenn Tesla grünes Licht bekommt, wird es nicht über Nacht passieren. Erst müssen Prüfstände und reale Tests überzeugen. Dann folgen Abstimmungen zu Haftung und Updates. Das dauert – aber es sorgt dafür, dass neue Funktionen nicht nur smart wirken, sondern sicher sind.
Die Hürden: Technik, Tests und Verantwortlichkeit
FSD ist ein Software‑Schwergewicht. Die Genehmiger wollen wissen: Welche Situationen deckt das System ab? Wo sind die Grenzen? Und wie wird das verlässlich getestet? Genau darum drehen sich FRAV und VMAD – von Mindestanforderungen bis hin zu Validierungsmethoden. Dazu kommen Cybersecurity, Over‑the‑Air‑Updates und die Pflicht, sicherheitsrelevante Änderungen transparent zu dokumentieren. Ein Kartenspiel mit vielen Regeln, das Tesla vollständig beherrschen muss.
In der Praxis läuft es so: Tesla beschreibt die Einsatzbedingungen (ODD), liefert Test‑ und Sicherheitsnachweise und weist nach, dass Notfallstrategien funktionieren. Behörden prüfen, ob das kohärent ist und ob das System auf der Straße robust bleibt. Das endet nicht mit der Zulassung: Updates müssen sicher ausgerollt und überwacht werden. Wer diese Kette sauber aufsetzt, hat die besten Chancen auf ein Ja.
Genauso wichtig ist die Frage der Verantwortung. Wer greift ein, wenn das System an seine Grenzen kommt? Was sagt das Handbuch? Wie werden Fahrerinnen und Fahrer vor falschen Erwartungen geschützt? Zulassungen setzen hier klare Leitplanken. Ein Versprechen zählt weniger als belastbare Daten. Deshalb ist es klug, wenn Tesla und Behörden früh über Beschränkungen reden – etwa Geofencing, Wettergrenzen oder Geschwindigkeitslimits. Transparenz schafft Vertrauen.
Für die FSD‑Zulassung in Europa bedeutet das: Ohne nachvollziehbare Tests und einen soliden Sicherheitsnachweis bleibt die Tür zu. Mit jedem klaren Nachweis öffnet sie sich ein Stück. Es ist ein Prozess, der Zeit kostet – aber Sicherheit verdient keinen Shortcut.
Ausblick: Was die FSD‑Einführung für dich bedeuten kann
Wenn Tesla die nächsten Hürden nimmt, wird die Einführung schrittweise laufen. Erst begrenzte Einsatzgebiete, klare Wetterfenster, klare Regeln. Später breitere Verfügbarkeit. Wahrscheinlich werden nationale Behörden Pilotphasen enger begleiten. Für Nutzer bedeutet das: Neue Funktionen erscheinen nicht auf einen Schlag, sondern wachsen mit jeder Freigabe. Wer sich darauf einlässt, sollte die Hinweise im Display ernst nehmen und Updates aufmerksam verfolgen.
Auch der Markt wird sich bewegen. Versicherer, Kommunen und Flottenbetreiber wollen wissen, wie zuverlässig FSD im Alltag ist. Gute Daten verkürzen Wege, schlechte verlängern sie. Für Tesla ist das eine Bewährungsprobe: Kann das Unternehmen zeigen, dass seine Software nicht nur in Kalifornien, sondern auch in Köln, Kopenhagen und Krakau sicher fährt?
Der rechtliche Rahmen entwickelt sich parallel. UNECE‑Gremien feilen an Details, die EU setzt den Rahmen in Brüssel um, und nationale Behörden bringen es auf die Straße. Das ist komplex, aber es schützt vor Schnellschüssen. Am Ende zählt, dass wir alle sicher ankommen – auch wenn die Technik viel kann. Die FSD‑Zulassung in Europa ist dadurch kein Selbstläufer, aber sie ist greifbar, wenn die Nachweise überzeugen.
Unser Tipp bis dahin: Updates lesen, Erwartungen managen, und bei neuen Funktionen nicht der Erste sein müssen. Abwarten zahlt sich oft aus – vor allem, wenn Sicherheit das Ziel ist.
Fazit
Tesla zielt auf eine Genehmigung über den UNECE‑Rahmen, der umgangssprachlich oft mit „Artikel 39“ verknüpft wird. Klar ist: Ohne robuste Regeln, Tests und transparente Verantwortlichkeiten gibt es kein Go. Die entscheidenden Gremien arbeiten daran, und nationale Behörden bereiten sich vor. Für Nutzer bedeutet das: Geduld, aber auch wachsende Chancen auf sichere, erweiterte Assistenzfunktionen. Der Kurs steht – das Tempo bestimmen die Nachweise.
Diskutiere mit: Wie stehst du zur FSD‑Einführung in Europa? Teile den Artikel, stelle deine Fragen in den Kommentaren und sag uns, welche Szenarien du dir wünschst!

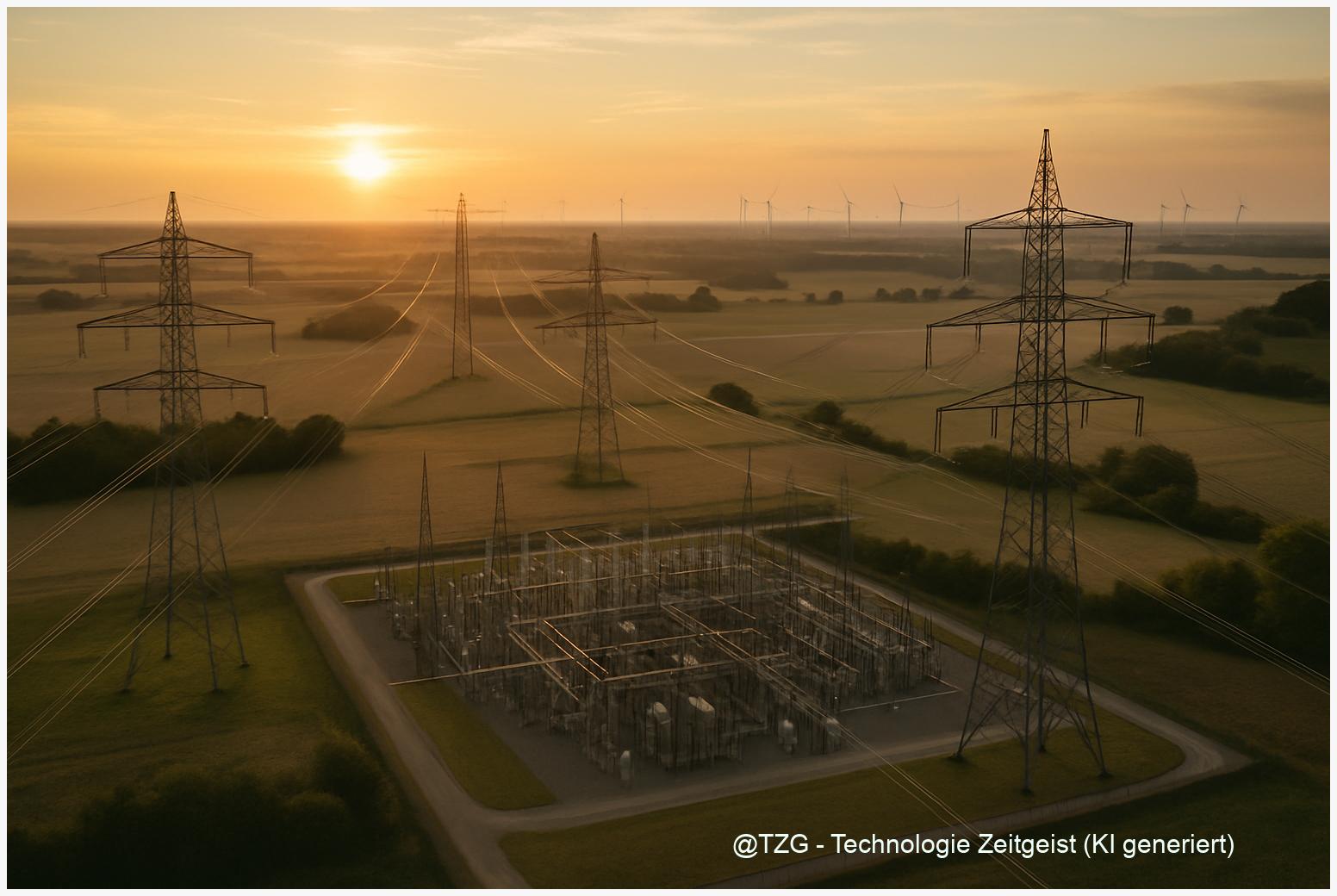


Schreibe einen Kommentar