Smarter Netzstabilitätsschub: STATCOM neue Technologien fürs Übertragungsnetz – kompakt erklärt und mit Praxisnutzen.
Kurzfassung
STATCOM neue Technologien fürs Übertragungsnetz kombinieren modulare Umrichter mit integrierter Energiespeicherung und grid-forming-Regelung. So lassen sich Spannung und Frequenz auch in schwachen Netzen stabilisieren und erneuerbare Einspeisung sicherer integrieren. Der Beitrag erklärt Trends, Topologien und Beschaffungstipps – inklusive konkreter Herstellerangaben und wissenschaftlicher Einordnung.
Einleitung
Blindleistungsunterstützung reagiert in unter <50 ms (Quelle, Produktseite; Stand: Q3 2025).
Dieser Zeithorizont entscheidet oft darüber, ob ein Frequenzknick zur Kettenreaktion wird – oder das Netz stabil bleibt. Die neue Generation von STATCOMs denkt dafür zwei Welten zusammen: modulare Multilevel-Umrichter mit smarter Regelung und integrierten Kurzzeitspeichern. Genau hier entsteht der Hebel für mehr Systemsicherheit bei viel Wind und PV.
Wir schauen auf die technischen Bausteine, was heute marktreif ist und wie Netzbetreiber die richtigen Spezifikationen wählen. Ohne Jargon-Overkill – aber mit handfesten Daten dort, wo es zählt.
Warum STATCOM jetzt aufrüstet
Der klassische STATCOM liefert Blindleistung, stabilisiert Spannung und hilft bei Störungen. Das bleibt wichtig, aber es reicht nicht mehr überall. Wechselnde Einspeisung, lange Leitungen und schwache Knoten fordern Geräte, die zusätzlich kurzfristig echte Wirkleistung liefern und sich wie „virtuelle Generatoren“ verhalten. Dieses Verhalten heißt grid-forming: Der Umrichter kann Spannung und Frequenz aktiv vorgeben, nicht nur folgen.
„Grid-forming verwandelt den STATCOM vom reaktiven Helfer zum aktiven Dirigenten – besonders wertvoll an wind- und PV-starken Netzknoten.“
Aktuelle Übersichtsarbeiten verorten den Trend klar: Modulare Multilevel-Converter (MMC) bilden die Basis, und Energiespeicher rücken direkt an den Umrichter heran – zentral am DC-/AC-Bus oder verteilt in Submodulen. Die Literatur betont, dass diese Integration Reaktionsfähigkeit, Spannungsqualität und Stabilität in schwachen Netzen verbessert, zugleich aber anspruchsvollere Regelung und Zustandsmanagement verlangt (z. B. Ladezustand der Speicher). Für den Einkauf heißt das: Nicht nur Mvar und kV spezifizieren, sondern auch Funktionen wie Spannungsformung, Schwarzstart-Optionen und Schnellreserve im Sekundenbereich.
Wie sieht das konkret aus? Ein prominentes Beispiel aus der Praxis kommt von Siemens Energy. Deren STATCOM-Plattform SVC PLUS bietet eine Variante mit integrierter Energiespeicherung, die aktive und reaktive Leistung zugleich adressiert. Einige harte Eckdaten dazu finden sich in der folgenden Tabelle und sind ein guter Realitätscheck – vom Leistungsband bis zur Reaktionszeit.
Tabellen sind nützlich, um Daten strukturiert darzustellen. Hier ist ein Beispiel:
| Merkmal | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Aktive Leistung (Referenzeinheit) | Kurzzeitige Wirkleistungsabgabe zur Frequenzstützung | ±50 MW (Siemens Energy; Produktseite; Stand: Q3 2025). |
| Blindleistung | Spannungsstützung und transiente Stabilität | ±70 Mvar (Siemens Energy; Produktseite; Stand: Q3 2025). |
| Energiespeicherinhalt | Superkondensatoren für sehr schnelle FFR | ≈450 MJ (Siemens Energy; Produktseite; Stand: Q3 2025). |
| Reaktionszeit Blindleistung | Dynamik bei Spannungseinbrüchen | <50 ms (Siemens Presse; älter: 2018). |
MMC-Topologien & Grid-Forming
MMC steht für Modular Multilevel Converter. Stell dir viele kleine Spannungsstufen vor, die zusammen eine saubere Welle ergeben. Der Vorteil: feine Regelung, geringe Oberschwingungen und Skalierbarkeit. Für STATCOMs bedeutet das: sehr präzise Blindleistungssteuerung, weniger Filteraufwand und bessere Dynamik. In Kombination mit geeigneter Steuerung kann ein MMC nicht nur folgen (grid-following), sondern führen – also grid-forming betreiben.
Die Forschung unterscheidet Varianten: Halbbrücken (effizient, aber eingeschränkte Fehlerbeherrschung), Vollbrücken (mehr Bauteile, dafür bessere Kurzschlussreaktion) und hybride Mischformen. Reviews heben hervor, dass hybride Ansätze oft das beste Verhältnis aus Verlusten, Schutz und Funktionalität liefern, abhängig vom Einsatzort im Netz. Wichtig: Die Auswahl der Submodultopologie beeinflusst direkt, ob ein STATCOM bei DC-/AC-Störungen weiterarbeiten und Spannung aktiv stützen kann.
Zur Regelung: Beliebt sind Droop-Regler, virtuelle Synchrongeneratoren (VSG) und hybride Modi, die je nach Netzstärke zwischen führen und folgen wechseln. Für den Betrieb mit Speicher kommt noch das Batteriemanagement hinzu: Der Ladezustand darf nicht an die Grenzen laufen, sonst fehlt genau dann aktive Leistung, wenn sie gebraucht wird. Praxisnahe Reviews ordnen diese Bausteine und nennen typische Einsatzfelder von Offshore-Anbindungen bis zu Knoten mit hoher PV-Dichte – ein guter Kompass für Planerinnen und Planer.
Ein zentrales Learning: Es gibt keine perfekte Topologie für alle Fälle. Wer Netzschutz, Verluste, Kosten und Bauzeit zusammen betrachtet, trifft bessere Entscheidungen. Deshalb gehören klare Nachweise für grid-forming-Fähigkeit, Fault-Ride-Through im DC-/AC-Fall und Testprotokolle für Störungen ins Programm. Für die konzeptionelle Einordnung empfehle ich die aktuelle Kurzreview zur MMC mit eingebetteter Energiespeicherung aus einem Fachjournal – sie bietet eine solide Übersicht zu Topologien, Regelung und Anwendungen (MDPI Electronics; Stand: Q1 2025).
Energiespeicher im STATCOM
Warum Speicher im STATCOM? Weil er damit nicht nur Spannung halten, sondern auch kurzfristig echte Leistung liefern kann – ideal für schnelle Frequenzstützung. Superkondensatoren glänzen hier mit extrem hoher Leistungsdichte und langlebigen Zyklen. Herstellerangaben belegen, dass integrierte Speicher die Lücke zwischen Trägheit aus großen Maschinen und langsameren Regelreserven schließen können. In der Praxis sorgen sie dafür, dass das Netz in kritischen Sekunden nicht ins Rutschen gerät.
Die Integration kann zentral am DC- oder AC-Knoten erfolgen oder verteilt in einzelnen Submodulen. Zentral ist einfacher zu bauen und zu warten; verteilt ist reaktionsschneller, aber komplexer beim Balancing. Für viele Übertragungsnetz-Betreiber bietet eine zentrale Integration einen guten Startpunkt, besonders wenn bestehende Schutzkonzepte weitergenutzt werden sollen. Entscheidend ist das Sizing: Wie viel Energie und Leistung braucht der Standort für typische Störungen? Welche Grenzwerte der Netzregeln müssen erreicht werden?
Konkrete Referenzen helfen beim Gefühl für Größenordnungen. Beim SVC PLUS FS von Siemens Energy wird die Blindleistung mit ±70 Mvar (Produktseite; Stand: Q3 2025)
angegeben, und eine Referenzeinheit stellt kurzfristig ±50 MW aktive Leistung (Produktseite; Stand: Q3 2025)
bereit. Der integrierte Energiespeicher kommt laut Hersteller auf rund 450 MJ (Produktseite; Stand: Q3 2025)
.
Wichtig: Diese Kurzzeitspeicher sind keine Ersatzbatterien für längere Ereignisse. Sie sind gebaut, um die kritischen Sekunden zu überbrücken und den Regelmarkt dahinter zu entlasten. Wer längere Stützung braucht, plant ergänzende Batteriespeicher ein – oder kombiniert mehrere STATCOM-Einheiten zu einem größeren „Stabilisierungsblock“.
Beschaffung, Netzcodes & Praxis-Check
Bevor ein Pflichtenheft rausgeht, lohnt ein Reality-Check: Welche Dienste braucht der Standort wirklich – nur Blindleistungsregelung oder auch schnelle Wirkleistung? Wie stark ist das Netz, welche Störungen sind typisch, und wie sehen die lokalen Netzcodes aus? Wer diese Fragen sauber beantwortet, vermeidet Fehlspezifikationen und spart teure Nachrüstungen.
Aus der Literatur ergibt sich ein klarer Fahrplan: Grid-forming-Fähigkeit mit konkreten Kenngrößen anfragen (z. B. Spannungsformung, Frequenzhaltung im Inselbetrieb), Fault-Ride-Through für DC-/AC-Störungen testen lassen und das Energiemanagement des integrierten Speichers bewerten. Eine kompakte, aber aktuelle Übersicht zu Topologien und Regelung liefert die Fachreview zur MMC mit eingebetteter Energiespeicherung (MDPI Electronics; Stand: Q1 2025). Sie fasst State-of-the-Art und typische Trade-offs verständlich zusammen.
Für die Herstellerseite gilt: Datenblätter sind nur der Anfang. Gefragt sind Testprotokolle und Messdaten aus dem Feld – etwa Reaktionsverhalten bei Spannungseinbrüchen und Verhalten bei wiederholten Einsätzen in kurzer Zeit. Herstellerangaben nennen für moderne Systeme eine sehr schnelle Blindleistungsreaktion von unter 50 ms (Presseangabe; älter: 2018)
. Projektteams sollten zusätzlich verifizieren, wie sich dies unter realen Thermik- und Alterungsbedingungen verhält.
Fazit
STATCOMs wachsen aus der Blindleistungsnische heraus. MMC-basierte Designs mit integrierter Speicherung und grid-forming-Regelung verschieben die Rolle Richtung aktiver Systemführer. Herstellerdaten zeigen, dass heute bereits sehr schnelle Reaktionen und nennenswerte Kurzzeitleistung verfügbar sind. Fachreviews liefern den technischen Unterbau und helfen, Topologien und Regelung passend zum Standort zu wählen. Wer Beschaffung und Test sauber plant, bekommt einen starken Stabilitätsbooster fürs Netz.
Jetzt Tiefe gewinnen: Fordert vom Hersteller ein Demo mit Messdaten am Zielknoten an – und definiert klare Performance-KPIs für euren ersten Piloten.
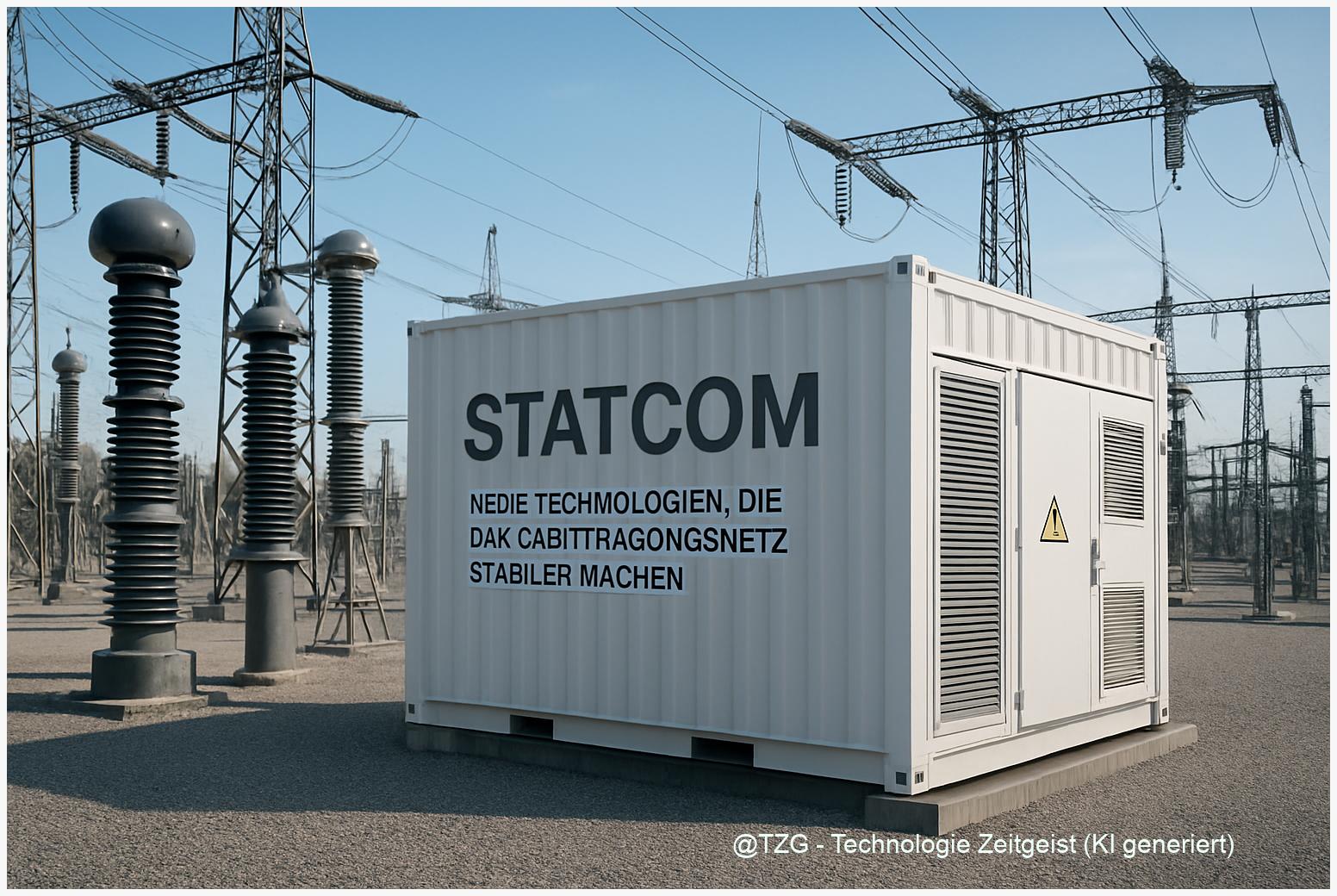

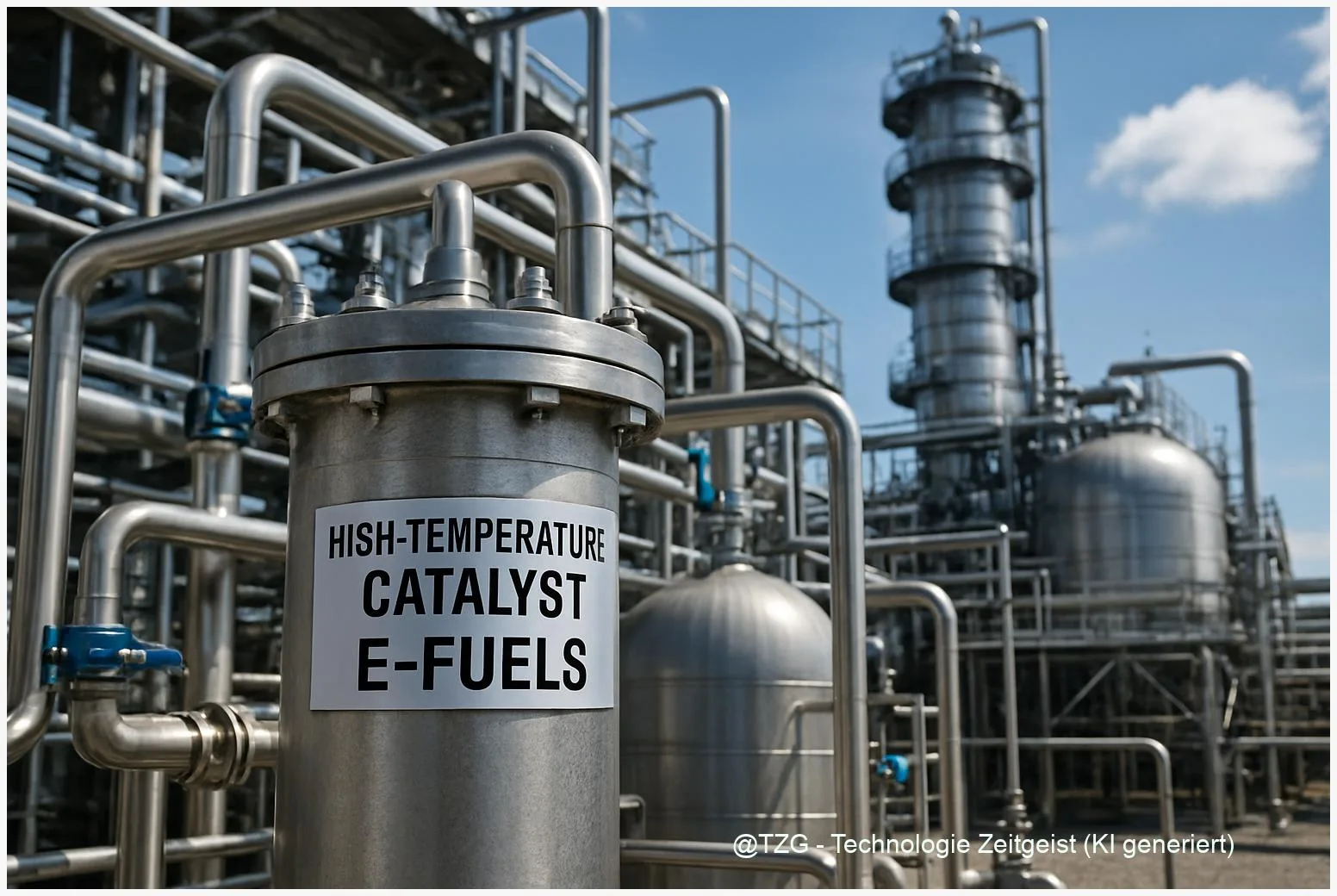

Schreibe einen Kommentar