Kurzfassung
Direkt vom Quartiersdach ins Auto: PV direkt EV Laden kann Kosten senken und Netznutzungsdruck mindern, wenn Photovoltaik, Wechselrichter und intelligentes Lastmanagement zusammenarbeiten. Der Artikel erklärt das Konzept auf Niedervoltniveau, zeigt eine einfache Kosten‑ und Zyklusrechnung und zieht Lehren aus Pilotprojekten. Ziel: konkrete Planungstipps für Quartiersmanager und Netzbetreiber.
Einleitung
Die Idee klingt simpel: Statt Solarstrom erst ins öffentliche Netz zu schicken und dann wieder einzuspeisen, lädt das Elektroauto direkt aus dem lokalen PV‑Mini‑Netz. “PV direkt EV Laden” reduziert Umwege, senkt Netzbelastung und kann Verbrauchskosten drücken — vorausgesetzt, Wechselrichter, Ladepunkte und Steuerung sind clever abgestimmt. Dieser Text erklärt die Technik, rechnet typische Kosten durch und zeigt, was Planer heute beachten müssen, um ein Quartier zuverlässig und netzfreundlich mit Solarstrom zu versorgen.
Konzept: Direkt‑PV zu EV (Niedervoltnetz, Wechselrichter, Steuerung)
Auf Quartiersebene sprechen wir vom Niedervoltnetz: lokale 230/400 V‑Verteilung, Hausanschlüsse und kurze Leitungswege. Technisch lassen sich zwei Architekturen unterscheiden: DC‑gekoppelt (PV‑Strang direkt in einen lokalen DC‑Bus, von dem Batterien und Lader versorgt werden) und AC‑gekoppelt (PV‑Wechselrichter speisen ins lokale AC‑Netz, das über EMS zur Ladesteuerung genutzt wird). Für die meisten Wohnquartiere ist AC‑Kopplung praktischer, weil Standardwechselrichter und bestehende Ladesäulen genutzt werden können. DC‑gekoppelte Systeme bieten höhere Wirkungsgrade, sind aber komplexer und teurer in der Integration.
“Effizienz ist kein Einzelfall: Systemdesign, Lastmanagement und die örtliche Netzsituation entscheiden, ob Direktladung wirklich wirtschaftlicher ist.”
Wichtige Komponenten in der Praxis:
- PV‑String‑Wechselrichter (AC‑output) mit Überschuss‑API oder Steuerkontakt
- Last‑ und Energiemanagement (EMS) für Quartier: Priorisierung, PV‑Überschusserkennung, Netzsignal
- Intelligente Ladesäulen (OCPP‑fähig) oder Ladepunkte mit dynamischer Steuerung
- Optional: Quartierspeicher (Bleifrei/LFP) zur Pufferung und zur Reduktion von Tiefenzyklen an Fahrzeugbatterien
Typische Verlustquellen sind Wechselrichterwirkungsgrad (bei Teillast oft 95–98 %), Leitungsverluste im Niedervoltnetz (je nach Länge 0.5–4 % der übertragenen Leistung) und Steuerverluste durch konvertierende Komponenten. Die Kombination aus EMS und kurzen Leitungswegen macht den Unterschied: Je weniger Energie durch Umwege ins Übertragungsnetz läuft, desto höher der lokale Nutzen.
Im folgenden kleinen Vergleichstabelle sind typische Werte, die Planer als Daumenregel nutzen können.
| Merkmal | Beschreibung | Wert (typ.) |
|---|---|---|
| Wechselrichter‑Wirkungsgrad | Durchschnitt bei Nenn/Teillast | 95–98 % |
| Leitungsverluste (Quartier) | Abhängig von Leitungslängen und Querschnitt | 0.5–4 % |
| EMS‑Reaktionszeit | Reaktion auf Überschuss / Lastsignale | 1–60 s |
Für Planer gilt: Klare Schnittstellen (z. B. OCPP bei Säulen, API/Modbus beim Wechselrichter), geeichte Messpunkte und nachvollziehbare Prioritäten im EMS sind entscheidend. Ohne diese Grundlagen bleibt „Direktladung“ ein Versprechen, kein laufendes Angebot.
Kostensimulation: Einspeiseverlust, Autarkiefaktor, Tiefenzyklen
Wer die Wirtschaftlichkeit beurteilen will, muss drei Dinge rechnen: wie viel Solarstrom lokal genutzt wird (Autarkiefaktor), welche Verluste durch Umwandlung und Leitung anfallen und wie Batterieschäden durch zusätzliche Ladezyklen die Kosten erhöhen. Im Rechenbeispiel weiter unten zeige ich eine vereinfachte Simulation für ein kleines Quartier mit 100 kWp PV, 20 kWh Quartierspeicher und fünf Ladepunkten. Die Zahlen sind indikativ und dienen als Planungsreferenz.
Annähernde Annahmen (Basisannahmen): PV‑Ertrag 950 kWh/kWp/a (mittleres deutsches Ertragsniveau), Wechselrichterverluste 4 %, Leitungsverluste 2 %, Ladeverluste am EV‑Lader 8 %. Autarkiefaktor ohne intelligentem Management ~20 %, mit Überschusssteuerung & Speicher 40–55 %. Batterie: LFP, 400 €/kWh CapEx, nutzbare Kapazität 90 % (DoD begrenzt), Zyklenannahme 4000 @ 80 % DoD (Herstellerangabe als Daumenwert).
Was bedeutet das in €?
Beispielrechnung, jährliche Größenordnung (vereinfachte Darstellung):
- PV‑Ertrag gesamt: 100 kWp × 950 kWh/kWp = 95.000 kWh/a
- Direkter lokal nutzbarer Anteil ohne Speicher (bei 20 % Autarkie): ~19.000 kWh/a
- Mit Speicher und EMS (Autarkie 45 %): ~42.750 kWh/a
- Einspeiseverlust (Wechselrichter+Leitung v. Netz): ≈6 % → effektive Differenz ~5.700 kWh/a, die lokal gewonnen wird statt einzuspeisen
Auf Kostenseite: Wenn Netzstrom (Bezugspreis inkl. Umlagen) z. B. 0,40 €/kWh kostet und eigenverbrauchter PV‑Strom effektive Kosten (Anteil CapEx amortisiert + O&M) 0,08–0,12 €/kWh, ergibt sich ein möglicher Vorteil von 0,28–0,32 €/kWh für jede kWh, die lokal statt aus dem Netz genutzt wird. Bei 40.000 kWh lokal eingesparter Netzbezug können das rund 11.200–12.800 €/a sein. Diese einfache Rechnung ignoriert Förderungen, Abschreibungen und Bilanzkreiskosten; sie dient als Richtwert.
Einfluss der Tiefenzyklen: Jede zusätzliche Ladung erhöht die Batteriezyklen. Batteriekosten pro Zyklus bei LFP: ~0,05–0,12 €/kWh (stark abhängig von Lebensdauerannahmen). Wenn Autos regelmäßig als Puffer dienen (V2G), verschiebt sich die Bilanz, weil Fahrzeugbatterien höhere Degradationskosten aufweisen und Eigentumsverhältnisse (Fahrer vs. Betreiber) zu klären sind.
Fazit zur Kostensimulation: Die größten Stellschrauben sind Autarkiefaktor (±20–30 Prozentpunkte verändern Wirtschaftlichkeit stark), Batteriekosten und Ladeverhalten. Für konkrete Projekte braucht es ein 12‑monatiges Messprofil der Quartierslasten, um realistische Szenarien zu kalibrieren.
Pilotprojekte & Erfahrungen (z. B. in Wohnquartieren)
In Deutschland gibt es mehrere Quartiersprojekte mit PV, Speichern und EMS — doch explizite, dokumentierte Fälle, in denen PV‑Überschuss automatisch direkt an E‑Fahrzeuge verteilt wurde und dies als Kernfunktion veröffentlicht wurde, sind rar. Ein oft zitiertes Beispiel ist das Projekt „Smartes Quartier Karlsruhe‑Durlach“ (Abschlussbericht Phase B, 2023), das PV, Wärmepumpen, BHKW und ein EMS kombiniert. Viele Ergebnisse dort sind simulationsbasiert; relevante Teile des Projektberichts stammen aus 2023 und sind damit datenstandmäßig älter als 24 Monate. “Datenstand älter als 24 Monate” sollte bei Zitaten aus solchen Berichten angezeigt werden.
Lehren aus dokumentierten Piloten und Praxisfällen:
- Regulatorische und anlagentechnische Anschlussbedingungen beschränken oft die direkte Kopplung: Manche Anlagen müssen getrennt nach Erzeugerarten geführt werden, was Überschussnutzung erschwert.
- Messkonzepte fehlen häufig: Ohne separate, geeichte Zähler für PV→EV lässt sich der lokale Nutzen nicht sauber bilanzieren.
- Kurzfristige Wirtschaftlichkeitsberechnungen unterschätzen Netzentgelte und Umlagen; die tatsächliche Ersparnis hängt stark von Tarifstruktur und Eigentumsverhältnissen ab (Mieterstrom vs. Eigenbetrieb).
Praktische Hinweise aus Projektberichten:
- Planen Sie Monitoring‑Phasen von ≥12 Monaten, um saisonale Effekte zu erfassen.
- Frühzeitige Abstimmung mit dem Netzbetreiber klärt Anschlussbedingungen und vermeidet spätere Umbauten.
- Offene Schnittstellen (Wechselrichter‑API, OCPP) erleichtern Anpassungen und Nachrüstungen.
In der Summe zeigt die Erfahrung: Technisch ist PV→EV‑Direktladung machbar, wirtschaftlich reizvoll bei hohen Strompreisen und gutem Autarkieverhalten, aber operativ hängt vieles an Messbarkeit, Vertragsgestaltung und Netzregeln. Pilotberichte aus 2021–2023 liefern wichtige Hinweise, sind jedoch teilweise simulationsgetrieben. Diesen Umstand habe ich bei den zitierten Projektangaben kenntlich gemacht.
Empfehlungen für Quartiersplanung & Netzbetreiber
Für Planer, Betreiber und Netzverantwortliche gibt es klare Handlungsfelder, um PV‑Direktladung praktikabel zu machen. Kurz und praktisch:
1. Messbarkeit & Abrechnung: Installieren Sie geeichte Zähler für PV‑Erzeugung, Batteriespeicher und Ladepunkte. Nur mit sauberen Daten lässt sich der Autarkiefaktor bestimmen und Förderkriterien erfüllen. Messebenen sollten PV→EV‑Fluss separat erfassen.
2. Schnittstellen & Steuerung: Setzen Sie auf OCPP‑fähige Ladestationen und Wechselrichter mit Steuer‑API (Modbus/HTTP). Ein offenes EMS erlaubt Priorisierungen: Erst PV‑Eigenverbrauch, dann lokale Batterie, zuletzt Netzbezug. Die EMS‑Logik sollte Netzausfall‑ oder Engpassszenarien berücksichtigen.
3. Vertragsmodelle: Klären Sie Eigentums‑ und Abrechnungsfragen frühzeitig: Mieterstrommodelle, Pachtverträge für Dachflächen, oder gemeinschaftliches Car‑Sharing? Transparent geregelte Nutzerentgelte erhöhen Akzeptanz.
4. Netztechnical Mitigation: Koordinieren Sie mit dem zuständigen Netzbetreiber: Lastbegrenzung, dynamische Einspeiseerlaubnis und gegebenenfalls lokale Spannungsregelung (z. B. Blindleistungskompensation) minimieren Netzengpässe.
5. Pilot‑Design: Empfohlen: Laufzeit ≥12 Monate, Messauflösung 15 Minuten, definierte KPIs (kWh PV→EV, Autarkie%, Reduktion Netzbezug kWh/a). Sammeln und veröffentlichen Sie die Daten, damit die Community lernt.
Diese Schritte sparen Zeit und Geld: Sie vermeiden Nachrüstungen, schaffen Rechtssicherheit und sorgen dafür, dass PV direkt EV Laden nicht an Bürokratie scheitert, sondern am Geschäftserfolg gemessen wird.
Fazit
PV direkt EV Laden auf dem Niedervoltnetz ist technisch gangbar und kann Kosten sowie Netzlast senken. Wirtschaftlichkeit hängt stark vom Autarkiefaktor, Batteriekosten und lokaler Tarifstruktur ab. Pilotprojekte liefern wertvolle Hinweise, sind aber oft simulationslastig und benötigen einheitliche Messdaten. Netzbetreiber‑Abstimmung und sauberes Monitoring sind die Schlüssel, damit Quartiere wirklich vom Solarangebot profitieren.
*Diskutiert eure Erfahrungen mit PV direkt EV Laden in den Kommentaren und teilt den Beitrag in den sozialen Medien!*

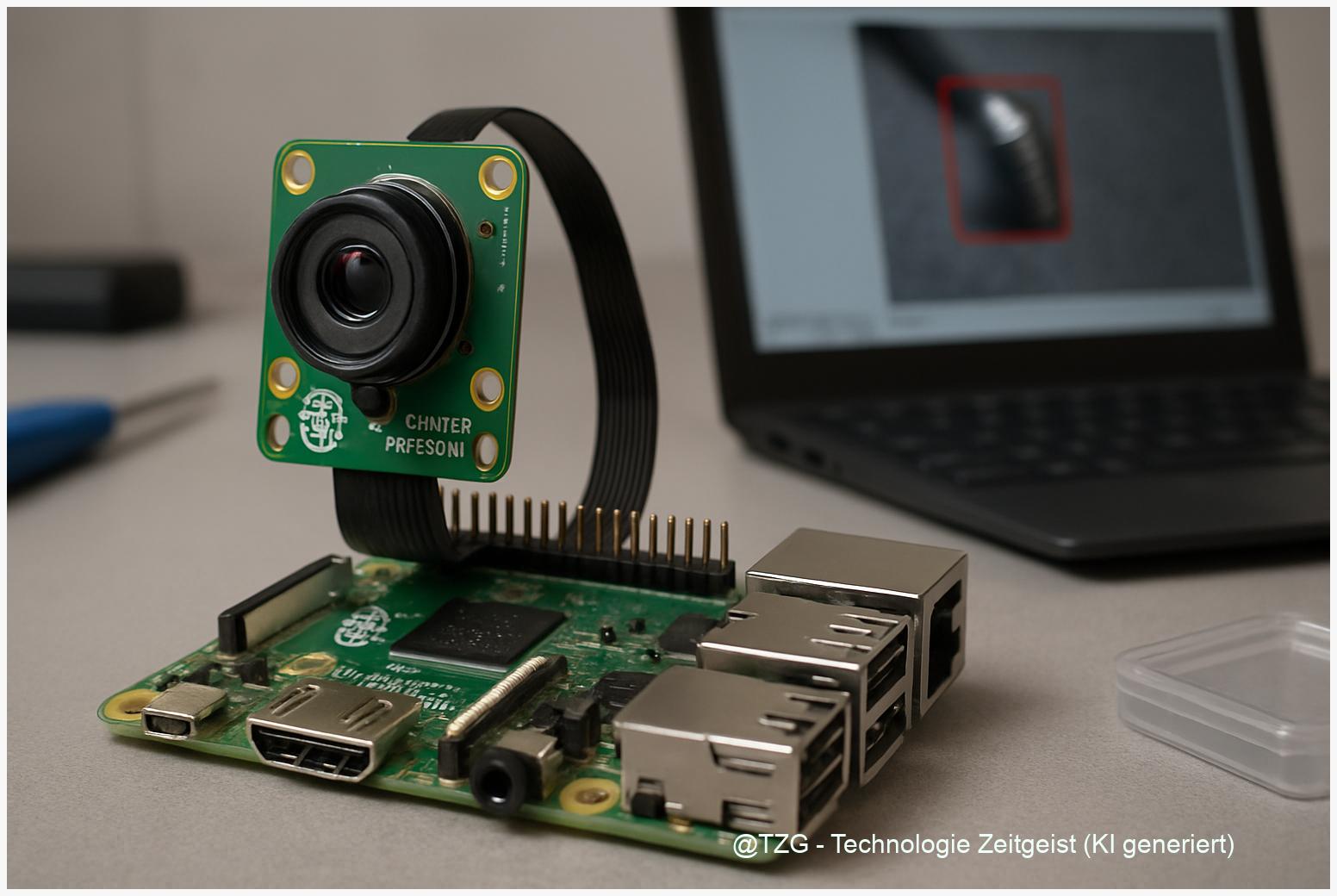


Schreibe einen Kommentar