Perowskit‑Silizium-Tandem-Zellen koppeln zwei Solarernteschichten, um mehr Sonnenlicht in Strom zu verwandeln. Im Labor liegen Messwerte über 31 % und jüngere Arbeiten zeigen sogar deutlich darüber liegende Werte; das macht Tandems interessant für Dächer und Freiflächen, die schon heute begrenzten Platz haben. Der Text erklärt, wie die Technik funktioniert, welche Praxisprobleme noch offen sind und worauf es beim Blick auf Stabilität, Recycling und Marktreife ankommt.
Einleitung
Wer heute ein Solarpanel kauft, erwartet nachvollziehbar hohe Effizienz und eine lange Lebensdauer. Siliziumdominiert seit Jahrzehnten den Markt, doch die physikalische Grenze für einzelne Siliziumzellen liegt bei etwa 29 % unter realistischen Bedingungen. Perowskit‑Silizium-Tandems setzen genau hier an: eine dünne Perowskitschicht fängt einen Teil des Lichts ein, den Silizium weniger effizient nutzt. Dadurch kann auf derselben Fläche mehr Strom erzeugt werden.
Das klingt theoretisch simpel, in der Praxis geht es aber um Materialfragen, Herstellungsverfahren und Langzeittestdaten. Hersteller und Forschungsinstitute berichten inzwischen von Laborwerten über 31 % und Modulversuchen mit rund 25 %; das verschiebt die Diskussion von „Geht das überhaupt?“ zu „Wann ist es verlässlich und bezahlbar?“. Dieser Text führt durch die Technik, die praktischen Anwendungen und die verbleibenden Hürden.
Wie Perowskit‑Silizium-Tandems funktionieren
Ein Tandem kombiniert zwei Solarzellen, die unterschiedliche Wellenlängen des Sonnenlichts besonders gut nutzen. Die oberste Schicht besteht aus Perowskit, einem kristallinen Material, das leicht herstellbar ist und Licht im blauen bis grünen Bereich gut in Elektrizität umwandelt. Darunter liegt die bewährte Siliziumzelle, die stärkeres, rotes und infrarotes Licht nutzt. Zusammen erhöhen sie den Anteil des verwerteten Lichts.
Perowskit dient als „Aufsatz“ für Silizium: klein in Materialaufwand, groß im Zugewinn an Ertrag.
Technisch gibt es zwei übliche Konzepte: monolithische Tandems, bei denen Schichten direkt übereinander aufgebaut werden, und mechanisch gestapelte Tandems, bei denen zwei fertige Zellen elektrisch verbunden werden. Monolithische Lösungen versprechen geringere Fertigungskosten, sind aber empfindlicher in der Herstellung. Ein zentrales Thema ist die Passivierung: damit möglichst wenige Ladungsträger verlorengehen, müssen Grenzflächen sauber und stabil sein.
Hier eine kurze Vergleichsübersicht, die typische Charakteristika zusammenfasst:
| Merkmal | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Typische Labor-Effizienz (Tandem) | Aktuelle Spitzenwerte in Forschungslabors | 31.6 % (Zelle) / 25 % (Modul) |
| Materialaufwand | Dünne Perowskitschicht auf Standard-Silizium | Gering im Vergleich zu Silizium |
Wichtig ist: Effizienzangaben beziehen sich meist auf Laborbedingungen (Standard-Testbedingungen). Für den Praxiseinsatz zählen Modulwerte, Alterungsraten und das Verhalten bei realem Lichteinfall. Forscher arbeiten deshalb an Lösungen für robuste Verkapselung und Industrie-geeignete Beschichtungsverfahren wie Blade-Coating oder Verdampfungstechniken.
Einsatz im Alltag: wo Tandems Strom liefern
Auf dem Dach eines Einfamilienhauses, auf Parkplätzen oder großen Freiflächen gilt eine einfache Rechnung: Je höher die jährliche Stromausbeute pro Quadratmeter, desto besser die Wirtschaftlichkeit. Perowskit‑Silizium-Tandems erhöhen die kWh-Ausbeute auf gleicher Fläche; das ist besonders auf Flächen mit hoher Flächennutzung relevant, etwa städtische Dächer oder gewerbliche Anlagen.
Praktisch bedeutet das: Ein Tandem-Modul mit höherer Effizienz erzeugt mehr Strom pro Panel, verringert die Anzahl benötigter Module und kann so Installationskosten für Wechselrichter, Gestell und Verschaltung senken. Erste Pilotmodule zeigen bereits Modulwirkungsgrade um 25 %. Gleichzeitig sind Temperatur- und Lichtwinkel-Effekte wichtig: Tandems können im Morgen- und Abendlicht anders reagieren als reine Siliziummodule, was die Ertragsprognose beeinflusst.
Für Betreiber sind drei Fragen zentral: Wie lange hält das Modul? Lässt es sich zertifizieren? Und wie sieht die Versorgungskette aus? Zertifizierungsprogramme für Tandems werden angepasst, weil Messungen beider Schichten berücksichtigt werden müssen. Zudem beeinflusst die Wahl der Verkapselung, wie gut das Modul Feuchtigkeit, UV-Licht und Temperaturschwankungen standhält.
Für private Nutzer könnte die Einführung so aussehen: in den nächsten Jahren kaufen frühe Anwender Pilotmodule oder Hybrid-Module von Herstellern, die bereits industrielle Linien angepasst haben. Gewerbliche Betreiber und Solarfonds könnten Tandems zuerst in Projekten mit begrenzter Fläche einsetzen, wo Effizienzvorteile den Mehraufwand rechtfertigen.
Chancen und Risiken klar erklärt
Die Chancen sind übersichtlich: mehr Strom auf gleicher Fläche, potenziell niedrigere Kosten pro kWh und ein schnellerer Beitrag zur Energiewende auf Flächen mit Beschränkungen. Höhere Effizienzen reduzieren außerdem die benötigte Menge an Trägerstruktur und seltenen Rohstoffen pro erzeugter Kilowattstunde.
Gleichzeitig bestehen Risiken: Stabilität und Alterungsverhalten sind noch nicht so gut dokumentiert wie bei konventionellen Siliziummodulen. Perowskitmaterialien enthalten meist Blei, wodurch Recycling und Rücknahme wichtig werden. Forschungsarbeiten zeigen jedoch Ansätze zur Rückgewinnung des Bleis und zur sicheren Verkapselung, sodass die Umweltwirkung im LCA-Vergleich meist vorteilhaft bleibt, wenn Module lange halten.
Ein weiteres Spannungsfeld ist die Fertigung: Methoden, die in Laboren funktionieren (Spin-Coating), sind für die Industrie ungeeignet. Verfahren wie Blade-Coating oder eine Kombination aus Verdampfung und Nassprozessen sind vielversprechend, erfordern aber Investitionen in Produktionsanlagen. Auch Normen und Prüfprotokolle werden derzeit erweitert, damit Module verlässlich zertifiziert werden können.
Für Verbraucher und Planer heißt das: Die Technik bringt klare Vorteile, aber die wirtschaftliche und ökologische Bilanz hängt stark von Lebensdauer, Recyclingkonzepten und der Qualität der industriellen Fertigung ab. Transparente Testdaten und Herstellerangaben sind deshalb entscheidend.
Perspektiven und mögliche Entwicklungen
In den nächsten Jahren dürfte sich das Bild schrittweise klären: Forschungslabore verbessern Passivierung und Grenzflächenbehandlung, während Industriepartner modulare Fertigungsverfahren testen. Erste Pilotlinien in Europa zeigen, dass die Umstellung auf Tandems technisch möglich ist; der Fokus verschiebt sich nun auf Skalierung und Kostenreduktion.
Eine wichtige Entwicklung ist die Integration von Design-for-Recycling. Wenn Module von Anfang an so konstruiert werden, dass kritische Stoffe am Ende der Lebensdauer zurückgewonnen werden können, verbessert das die Ökobilanz erheblich. Politische Vorgaben und Förderprogramme können diesen Prozess beschleunigen, indem sie Zertifizierungs- und Rücknahmepflichten unterstützen.
Auf der Technologieebene sind Kombinationen mit bifazialen Moduldesigns und optimierten Wechselrichtern denkbar, sodass die Effizienzgewinne voll ausgeschöpft werden. Auch kleine Verbesserungen bei der Alterungsrate haben großen Einfluss auf den Lebenszeit-Ertrag: wenn jährliche Degradation deutlich unter 1 % liegt, sind Tandems langfristig besonders attraktiv.
Insgesamt ist zu erwarten, dass Tandems zuerst in Segmenten mit hoher Flächennutzung und später in breiterer Produktion Fuß fassen. Wer sich heute mit dem Thema beschäftigt, gewinnt Verständnis für die Entscheidungen, die bei Planung und Investition in Solarprojekte künftig wichtig werden.
Fazit
Perowskit‑Silizium-Tandemzellen bieten einen klaren technischen Vorteil: auf gleicher Fläche lässt sich mehr Strom erzeugen als mit reinen Siliziummodulen. Die Forschungslandschaft meldet deutliche Effizienzgewinne, erste Module sind in Pilotserien erprobt. Entscheidend für den breiten Einsatz sind jedoch verlässliche Langzeitdaten, industrielle Fertigungsverfahren und funktionierende Recyclingketten. Solange diese Punkte bearbeitet werden, bleiben Tandems eine vielversprechende, aber noch nicht vollständig ausgereifte Ergänzung zur etablierten Photovoltaik.
Wenn Sie Fragen oder Erfahrungen haben, teilen Sie den Artikel und diskutieren Sie gern die Chancen von Tandem-Modulen.
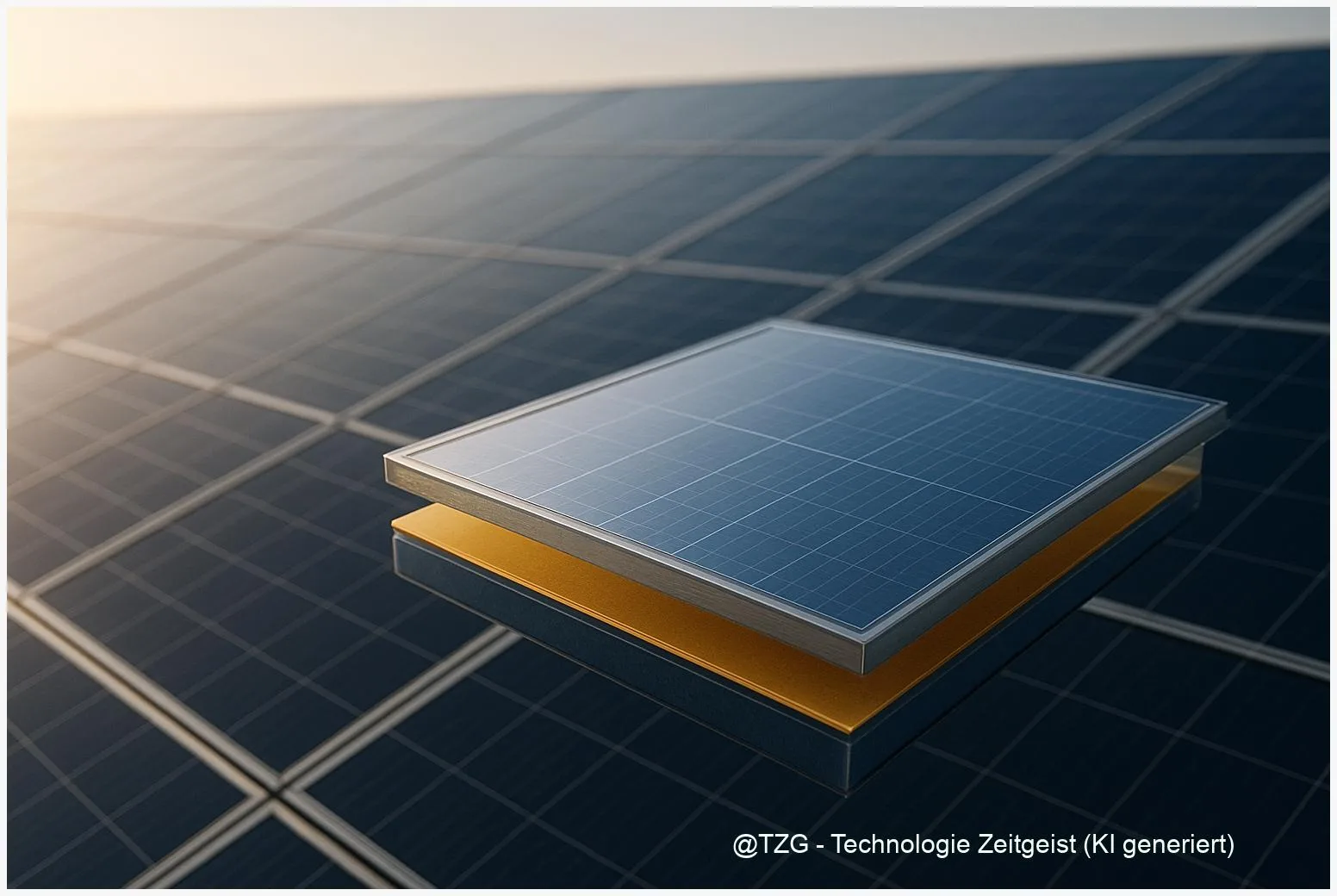



Schreibe einen Kommentar