Computer‑Use‑Agents sind Programme, die Bildschirminhalte lesen, Schlussfolgerungen bilden und dann Maus‑ und Tastaturaktionen ausführen. Sie können wiederkehrende Web‑ und Desktop‑Aufgaben automatisieren, aber sie verändern zugleich Sicherheits‑ und Datenschutzfragen. Dieser Text erklärt, wie Computer‑Use‑Agents technisch funktionieren, wo sie im Alltag sinnvoll eingesetzt werden, welche Chancen und Risiken es gibt und welche Vorkehrungen für sichere Nutzung sinnvoll sind.
Einleitung
Immer öfter gibt es Software, die nicht nur auf Texteingaben antwortet, sondern aktiv in Oberflächen handelt: Sie klickt Buttons, kopiert Inhalte und füllt Formulare. Solche Programme heißen Computer‑Use‑Agents. Sie verbinden maschinelles Verstehen von Bildschirminhalten mit der Fähigkeit, Eingaben zu simulieren. Für Nutzerinnen und Nutzer entsteht dadurch praktischer Nutzen: Routineaufgaben können Zeit sparen, komplexe Abläufe lassen sich vereinfachen. Gleichzeitig entstehen neue Fragen: Welche Daten sieht der Agent? Wer bestätigt kritische Aktionen? Und wie lässt sich Missbrauch verhindern?
Die folgenden Abschnitte erklären Schritt für Schritt, wie diese Agents arbeiten, zeigen typische Einsatzszenarien und nennen konkrete Sicherheits‑ und Datenschutzaspekte. Die Beschreibung stützt sich auf öffentlich zugängliche System‑Dokumentationen und Forschungsarbeiten aus den Jahren 2024–2025.
Was sind Computer‑Use‑Agents?
Computer‑Use‑Agents sind KI‑gestützte Programme, die drei Funktionen kombinieren: Wahrnehmung, Planung und Aktion. Wahrnehmung bedeutet hier meist Screenshot‑Analyse oder OCR; das System „liest” die sichtbare Benutzeroberfläche. Planung heißt, aus dem Gelesenen einen Schritt‑für‑Schritt‑Plan zu erstellen. Aktion ist die Nachahmung von Benutzerhandlungen, also Mausklicks, Tastendruck oder das Einfügen von Text.
Technisch basiert diese Kombination häufig auf großen Sprach‑ und Multimodalmodellen, die mit visuellen Eingaben trainiert wurden. Ein verbreitetes Muster ist: 1) Screenshot erfassen, 2) relevante Elemente erkennen (etwa Buttons, Eingabefelder), 3) Handlungsplan erzeugen, 4) simulierte Eingaben ausführen und 5) Ergebnis prüfen. Manche Implementierungen arbeiten vollständig in der Cloud, andere führen Teile der Verarbeitung lokal auf dem Gerät aus.
Der grundlegende Unterschied zu klassischen Makros ist die Fähigkeit, visuell zu interpretieren und flexibel auf unterschiedliche Layouts zu reagieren.
Einfach gesagt: Statt starrer, pixelbasierter Regeln können Computer‑Use‑Agents mit natürlicher Sprache und visueller Wahrnehmung komplexere, nicht‑vordefinierte Abläufe bearbeiten. Gleichzeitig sind sie anfällig für Fehler der visuellen Erkennung (OCR‑Fehler) und für Eingabe‑Manipulationen, die das System fehlleiten können.
Wenn Zahlen relevant sind: Herstellertests aus 2025 zeigen, dass solche Agents auf Live‑Webseiten deutlich bessere Erfolgsraten erreichen als bei vollständiger Betriebssystem‑Automatisierung (Beispielkennzahlen: ca. 87 % in bestimmten Live‑Web‑Szenarien vs. rund 38 % für komplette OS‑Aufgaben; die Werte stammen aus öffentlichen Systembeschreibungen). Diese Unterschiede entstehen, weil Weboberflächen oft strukturiertere Informationen bieten als beliebige Desktop‑Anwendungen.
Die Architektur lässt sich grafisch in drei Schichten denken: Perception (Screenshots, OCR), Reasoning (LLM‑Logik, Aktionsplanung) und Actuation (virtuelle Maus/Tastatur, API‑Calls). Jede Schicht hat eigene Fehlerquellen und Sicherheitsanforderungen.
| Merkmal | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Perception | Screenshots, OCR, visuelle Labelerkennung | Fehleranfällig bei Zufallsstrings |
| Reasoning | Planung und Kontextverstehen durch LLM | Flexibel, aber prompt‑sensitiv |
Wie sie im Alltag Aufgaben übernehmen
Im Alltag treten Computer‑Use‑Agents heute vor allem dort auf, wo wiederkehrende Abläufe anfallen: E‑Mail‑Sortierung, Terminerinnerungen, einfache Recherchen, Ausfüllen von Formularen oder das Sammeln von Informationen aus mehreren Webseiten. Anders als klassische Automatisierungstools können sie dabei sprachliche Anweisungen verstehen und auf wechselnde Benutzeroberflächen reagieren.
Konkretes Beispiel: Ein Agent erhält die Aufgabe, in einem Webshop nach einem bestimmten Artikel zu suchen, Verfügbarkeit zu prüfen und einen Kauf vorzubereiten. Er macht einen Screenshot, erkennt Suchfeld und Warenkorb‑Button, führt die Suchanfrage aus, prüft Preisangaben und meldet dem Menschen die relevanten Optionen. Entscheidet der Nutzer, den Kauf abzuschließen, führt der Agent die notwendigen Klicks aus — sofern er dafür autorisiert ist.
Ein anderes Einsatzfeld sind Firmen‑Workflows: Reporting‑Tools, die Daten aus verschiedenen Web‑Dashboards zusammentragen, oder Service‑Bots, die Support‑Tickets mit Informationen aus internen Web‑Apps anreichern. Auch für Menschen mit motorischen Einschränkungen können solche Agents echte Erleichterung bringen, weil sie Arbeitsschritte automatisieren, die sonst mühsam wären.
Wichtig für den praktischen Einsatz sind Schutzmechanismen: sensible Aktionen (Geldüberweisungen, Passwortänderungen) sollten niemals ohne ausdrückliche, erneute Bestätigung durch einen Menschen erlaubt sein. In Hersteller‑Tests aus 2025 betonten Anbieter als Standardmaßnahmen Confirmations für kritische Aktionen und Watch‑Modes, in denen der Mensch Eingriffe überwacht.
Für viele Anwender liegt der unmittelbare Nutzen in der Zeitersparnis und im Wegfall monotoner Arbeitsschritte. Für Organisationen ergeben sich Effizienzgewinne, aber auch neue Anforderungen an Governance: Wer legt Rechte fest? Wie lange werden Aktionstraces gespeichert? Wie werden Fehler rückgängig gemacht?
Chancen, Risiken und Spannungsfelder
Die Chancen sind konkret: Produktivitätssteigerung, barrierefreie Bedienung und die Möglichkeit, komplexe, mehrstufige Abläufe ohne manuelles Eingreifen zusammenzuführen. Zugleich bestehen reale Risiken, die nicht nur theoretisch sind.
Ein Risiko betrifft Privatsphäre: Agents sehen alles, was auf dem Bildschirm erscheint. Ohne klare Zugriffsbeschränkungen können sie an sensible Daten gelangen. In Feld‑ und Laborstudien aus 2024 zeigte sich außerdem, dass schlecht geschützte Agenten in vielen Fällen automatisiert genutzt werden können, um Logins oder Dateien zu exfiltrieren; entsprechende Experimente gelangten in Laborbedingungen auf Erfolgsraten von rund 80 % für bestimmte ungeschützte Szenarien.
Sicherheitsforscher warnen vor Prompt‑ und UI‑Injection: durch manipulierte Seiten oder Eingaben lässt sich ein Agent fehlleiten. Herstellerantworten sehen mehrere Abwehrschichten vor: Modell‑Level‑Refusals, Bestätigungen für sensible Vorgänge, Prompt‑Injection‑Detectoren und Produktregeln, die bestimmte Domains oder Aktionen von vornherein sperren. In internen Tests berichteten Anbieter 2025 über sehr hohe Ablehnungsraten für riskante Aufgaben (beispielsweise ≈97 % Ablehnung in bestimmten Evalsets) und über automatische Prüfmechanismen gegen manipulierte Eingaben.
Ein weiteres Spannungsfeld ist die Frage nach Verantwortlichkeit und Auditierbarkeit: Wer haftet, wenn ein Agent eine falsche Aktion durchführt? Technisch lässt sich das durch detailliertes Logging und Replay‑Funktionen besser nachverfolgen. Operativ sinnvoll sind zudem Begrenzungen auf Whitelisted‑Tools und die Anwendung des Prinzips der geringsten Rechte (least privilege).
Schließlich besteht das Risiko, dass solche Agenten von Angreifern zur Automatisierung von Angriffen genutzt werden — zum Beispiel für massenhafte Phishing‑Kampagnen oder automatisierte Kontoübernahmen. Sicherheitsstudien aus 2024–2025 heben hervor, dass Isolation (Sandboxing) und Session‑Containment in Tests sehr wirksam sind; eingeschränkte Agent‑Umgebungen verhinderten in Experimenten viele Kompromittierungen.
Blick nach vorn: Entwicklung und Absicherung
In den nächsten Jahren ist mit einer breiteren Verfügbarkeit von Computer‑Use‑Agents zu rechnen, sowohl als Cloud‑Dienste als auch als lokale, on‑device‑Lösungen. On‑device‑Varianten reduzieren Datenübertragungen in die Cloud, verlagern aber das Risiko auf Endgeräte und erfordern starke lokale Sicherheits‑Vorkehrungen.
Technische Maßnahmen, die sinnvoll sind und bereits Wirksamkeit zeigen, sind: Sandboxing/Containerisierung der Agent‑Ausführung, verpflichtende menschliche Bestätigungen für Side‑Effect‑Aktionen, Whitelists für erlaubte Tools sowie lückenloses Audit‑Logging. Außerdem helfen Red‑Team‑Übungen, reale Angriffsvektoren zu identifizieren. Einige Forschungen nennen zusätzlich kryptografische Ansätze (z. B. Format‑preserving Encryption oder homomorphe Verfahren) als Perspektive, um Daten zu schützen, ohne Nutzbarkeit völlig zu verlieren — diese Ansätze sind jedoch noch aufwändig und mit Performance‑Trade‑offs verbunden.
Regulatorisch dürften Organisations‑ und Branchenrichtlinien die Nutzung begleiten: Mindestanforderungen an Transparenz, Meldung sicherheitsrelevanter Vorfälle und Prüfpfade für automatisierte Aktionen. Für Endnutzer bleibt wichtig, Rechte auf Agent‑Ebenen einschränken zu können, etwa durch einfache Schalter, die den Zugriff auf Zahlungs‑ oder Gesundheitsseiten sperren.
Wer heute Agents einführt, sollte mit kleinen, klar umrissenen Einsatzfällen beginnen: Standardaufgaben, die reversibel sind und keine hochsensiblen Daten betreffen. Parallel dazu gehört ein Monitoring‑Plan: Metriken zur Anzahl bestätigter Aktionen, zu Ablehnungen bei verdächtigen Anfragen und zu falsch positiven Erkennungen helfen, die Balance zwischen Sicherheit und Komfort zu steuern.
Fazit
Computer‑Use‑Agents bündeln visuelle Wahrnehmung und Sprach‑Intelligenz, um wiederkehrende Arbeiten am Computer zu automatisieren. Sie bieten nützliche Effizienzgewinne, stellen aber zugleich höhere Anforderungen an Zugriffskontrolle, Auditierbarkeit und Nutzeraufklärung. Technisch sind Sandboxing und explizite Bestätigungsschritte wirksame Schutzmaßnahmen, und organisatorisch sind klare Regeln für Rechtevergabe und Logging nötig. Wer diese Werkzeuge nutzen will, kommt nicht ohne sorgfältige Abstufung von Rechten und kontinuierliche Tests aus.
Wenn Sie Erfahrungen oder Fragen zu Computer‑Use‑Agents haben, freuen wir uns über Ihre Kommentare und das Teilen dieses Artikels.
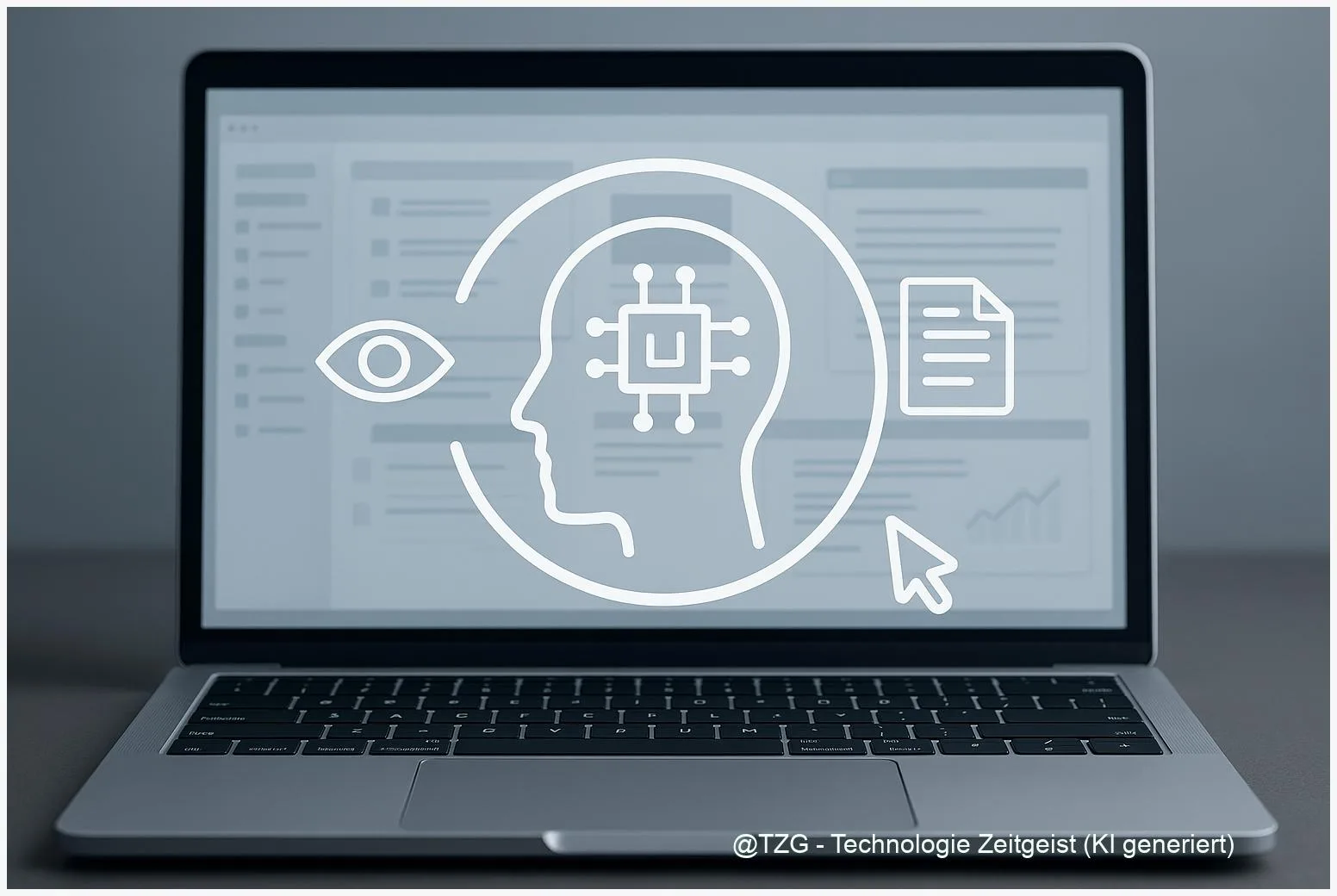
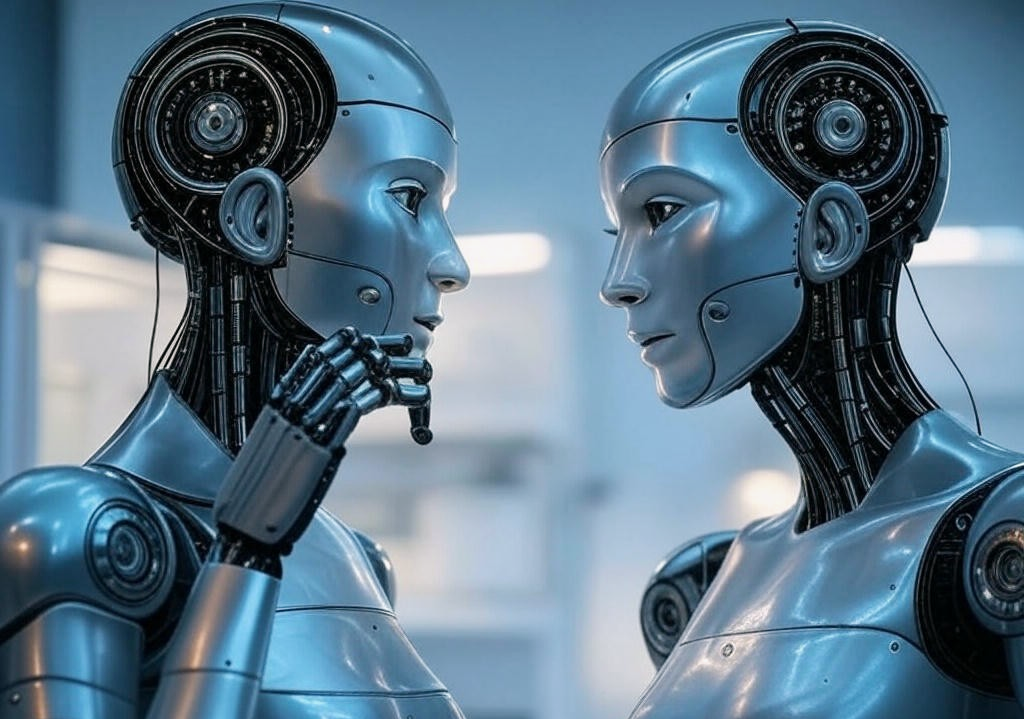


Schreibe einen Kommentar