Großspeicher am früheren AKW-Standort: Batteriespeicher Philippsburg erklärt – Daten, Zeitplan und Nutzen für das Netz in Deutschland.
Kurzfassung
Der Batteriespeicher Philippsburg entsteht auf dem Gelände des stillgelegten Kernkraftwerks und soll Deutschlands Netze flexibler machen. EnBW plant eine Anlage mit hoher Leistung und enger Anbindung an den ULTRANET‑Konverter von TransnetBW. Dieser Beitrag bündelt Kapazitäten, Zeitplan, Netznutzen und Risiken – verständlich erklärt und mit aktuellen Quellen belegt – damit ihr Chancen und Grenzen des Projekts realistisch einschätzen könnt.
Einleitung
Auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks Philippsburg plant EnBW einen Batteriespeicher mit 400 MW Leistung und 800 MWh Kapazität (Stand: Q3 2025) (Renewables Now).
Das Projekt greift direkt an den ULTRANET‑Konverter von TransnetBW an, der als Endpunkt einer rund 340 km langen Gleichstromverbindung fungiert. ULTRANET soll Ende 2026 in den Wirkleistungsbetrieb gehen (Stand: Q3 2025) (Bundesnetzagentur).
Was heißt das konkret für Versorgungssicherheit, Preise und die Energiewende?
Projektstatus, Leistung und Kapazität
Der Standort könnte kaum symbolischer sein: Wo früher Atomstrom ins Netz ging, soll bald ein Großspeicher kurzfristige Schwankungen ausgleichen. EnBW hat die Pläne öffentlich gemacht. Geplant sind 400 MW Nennleistung und 800 MWh Speicherkapazität am Standort Philippsburg (Stand: Q3 2025) (EnBW).
Unabhängige Branchenmedien bestätigen diese Größenordnung, die das Projekt in die Spitzengruppe deutscher Speicher hebt. Auch externe Berichte nennen 400 MW/800 MWh (Stand: Q3 2025) (Renewables Now).
“Vom Atommeiler zum Flexibilitätsanker: Philippsburg steht für den Pragmatismus der neuen Energiewelt.”
Was bedeuten diese Zahlen? 800 MWh bei 400 MW entsprechen rechnerisch rund zwei Stunden Vollast. Das passt zu Anwendungen wie Regelenergie, Frequenzhaltung und kurzer Lastverschiebung. Die finale Technik ist noch offen. EnBW spricht allgemein von einem Batteriespeicher; Zellchemie, Inverter und Brandschutzdetails sind öffentlich (Stand: Q3 2025) nicht spezifiziert (EnBW).
Entsprechend sind Lieferanten- und EPC‑Fragen noch unbeantwortet.
Tabellen sind nützlich, um Daten strukturiert darzustellen. Hier ist ein Überblick zum Projekt:
| Merkmal | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Leistung | Maximale Einspeiseleistung | 400 MW Quelle |
| Kapazität | Energiespeichervermögen | 800 MWh Quelle |
| Entladedauer | Rechnerisch bei Vollast | ≈ 2 h (800 MWh/400 MW) |
Beim Zeitplan bleibt EnBW vorsichtig. Eine Inbetriebnahme Ende 2027 erscheint möglich – vorbehaltlich Genehmigungen und Netzanschluss (Stand: Q3 2025) (EnBW).
Das ist ambitioniert, aber realistisch, falls Behörden, Lieferketten und der ULTRANET‑Zeitplan zusammenpassen.
Netzanschluss: ULTRANET und Rolle von TransnetBW
Ohne starken Netzanschluss bleibt ein Großspeicher nur ein teures Inselprojekt. In Philippsburg liegt die Stärke direkt nebenan: der ULTRANET‑Konverter von TransnetBW. ULTRANET verbindet Osterath (NRW) mit Philippsburg über rund 340 km Gleichstromleitung (Stand: Q3 2025) (Bundesnetzagentur).
Der Konverter arbeitet schon heute als STATCOM, also als Blindleistungs‑Stütze, bis die Leitung voll in Betrieb ist.
TransnetBW meldet für den Konverterstandort Philippsburg eine Fertigstellung Ende November 2024; seitdem läuft ein STATCOM‑Probebetrieb (Stand: Q3 2025) (TransnetBW Bautagebuch).
Sobald ULTRANET live geht, soll der Korridor bis zu 2 GW transportieren. TransnetBW nennt eine Übertragungsgröße von 2 GW für den ULTRANET‑Korridor (Stand: Q3 2025) (TransnetBW Bautagebuch).
Für den Speicher ist das ein Jackpot: So lassen sich Windspitzen aus dem Norden puffern und lokal ins Südwest‑Netz einspeisen.
Regulatorisch geht es voran. Die Bundesnetzagentur hat am 28. 08. 2025 einen weiteren Planfeststellungsbeschluss für ULTRANET gefasst; Ziel bleibt die Inbetriebnahme Ende 2026 (Stand: Q3 2025) (Bundesnetzagentur).
Für Philippsburg ergibt sich damit eine klare Abhängigkeit: Verzögert sich ULTRANET, verschiebt sich auch der ideale Start des Speichers. Umgekehrt kann der Speicher bereits vorher Netzdienste liefern, etwa Frequenzhaltung oder Engpassmanagement auf Verteilnetzebene.
Die Nähe zum Konverter reduziert Anschlusskosten und Leitungsverluste. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Schutz‑ und Leittechnik, etwa bei Schwarzstart‑Regeln, Inselbetriebsvermeidung und Brandschutz. Offizielle Detaildaten zu Topologie oder OEMs (z. B. VSC‑Technologie, Hersteller) sind öffentlich (Stand: Q3 2025) nicht final veröffentlicht. TransnetBW spezifiziert im Bautagebuch Funktion und Status, aber keine Herstellerdetails (TransnetBW Bautagebuch).
Markt, Erlösquellen und Risiken für Großspeicher
Großspeicher verdienen ihr Geld über mehrere Körbe: Arbitrage (kauf günstig, verkauf teuer), Netzdienste wie Primär‑ und Sekundärregelung sowie Engpassmanagement. EnBW stellt das Projekt ohne klassische Subventionen in Aussicht. Der Speicher soll über Marktumsätze und Netzdienstleistungen wirtschaftlich betrieben werden (Stand: Q3 2025) (EnBW).
Das mindert Abhängigkeiten, erhöht aber die Planungsanforderungen, weil Preise und Abrufe schwanken.
Risiken? Erstens Zeit. ULTRANET peilt Ende 2026 an; EnBW hält Ende 2027 für den Speicher – bei rechtzeitigen Genehmigungen – für möglich (Stand: Q3 2025) (Bundesnetzagentur), (EnBW).
Zweitens Technik. Zellchemie, Lieferkette und Brandschutz müssen zum Standort passen. Drittens Regulierung: Marktdesign und Netzentgelte beeinflussen Erlöse direkt. Viertens Betrieb: Zyklenkosten und Degradation entscheiden über Langfrist‑Performance.
Chancen? Die Lage ist Premium. Ein 2‑GW‑Korridor in der Nachbarschaft schafft Spielräume für hochdynamische Fahrweisen. Der Konverter ist seit 11/2024 in Betrieb (STATCOM) und stabilisiert bereits heute das Netz (Stand: Q3 2025) (TransnetBW Bautagebuch).
In Kombination mit PV‑ und Windparks im Südwesten ergeben sich attraktive Arbitrage‑Fenster. Wer früh startet, sammelt Betriebsdaten – ein Wettbewerbsvorteil, der sich nicht kopieren lässt.
Für Bürgerinnen und Bürger zählt: Wird Strom dadurch zuverlässiger? Kurz gesagt: Ja, wenn Koordination klappt. Speicher sind Feuerwehr und Schwamm zugleich – sie löschen Frequenz‑Brände und nehmen Erzeugungsüberschüsse auf. In Philippsburg skaliert dieser Effekt. Transparenz über Baufortschritt, Genehmigungen und Sicherheit bleibt dennoch Pflicht.
Roadmap bis Betriebsstart: Was jetzt kritisch ist
Damit der Speicher rechtzeitig ans Netz kommt, müssen drei Pfade zusammenlaufen: Genehmigungen, Netzanschluss und Lieferkette. Erstens: die Behördenebene. Die Bau‑ und Umweltunterlagen brauchen Sorgfalt, damit Auflagen nicht später den Betrieb einschränken. Zweitens: ULTRANET. Die geplante Inbetriebnahme Ende 2026 hängt an den letzten Planfeststellungen und Bauabschnitten; Fortschritte werden laufend veröffentlicht (Stand: Q3 2025) (Bundesnetzagentur).
Drittens: Technikverträge – von Zellen über Inverter bis zur Brandfrüherkennung.
Ein Vorteil in Philippsburg: bestehende Infrastruktur. Der Konverterplatz, Schaltfelder und Netzanschlusspunkte verkürzen Wege. TransnetBW dokumentiert fortlaufend Bau‑ und Betriebsstatus am Standort; die Konverteranlage ist fertiggestellt (11/2024) und als STATCOM aktiv (Stand: Q3 2025) (TransnetBW Bautagebuch).
Für den Speicher heißt das: Parallelisierung ist möglich – Bau, Test und Netzintegration können phasenweise erfolgen.
Bleibt die Frage nach dem besten Startfenster. Ein Go‑Live synchron mit ULTRANET maximiert Systemnutzen, doch auch ein gestaffelter Start ergibt Sinn: Zuerst Netzdienste, dann Marktarbitrage in größerem Stil. Entscheidend ist ein belastbarer Netzanschlussvertrag und eine klare Betriebsstrategie. EnBW spricht von einem marktbasierten Betrieb; konkrete CAPEX‑Zahlen sind öffentlich (Stand: Q3 2025) nicht genannt. Der Betreiber nennt keine finalen OEM‑Details oder Investitionssummen in den verfügbaren Mitteilungen (EnBW).
Praktischer Tipp: Projektupdates abonnieren, Gemeinderats‑ und BNetzA‑Protokolle verfolgen und lokale Informationsabende nutzen. So lassen sich Chancen früh erkennen – und Risiken pragmatisch abräumen.
Fazit
Philippsburg wird zum Taktgeber der Flexibilität: 400 MW/800 MWh schaffen netznahe Speicherkapazität am Ende eines 2‑GW‑Korridors. Der ULTRANET‑Zeitplan zielt auf Ende 2026; der Speicher könnte – genehmigungsabhängig – Ende 2027 folgen (Stand: Q3 2025) (Bundesnetzagentur), (EnBW).
Die Kombination verheißt weniger Abregelungen, stabilere Frequenz und smartere Nutzung erneuerbarer Erzeugung – vorausgesetzt, Technik und Regulierung ziehen mit.
Du willst Updates zu Großspeichern und Netzausbau zuerst lesen? Abonniere unseren Newsletter und bleib am Projekt Philippsburg dran.
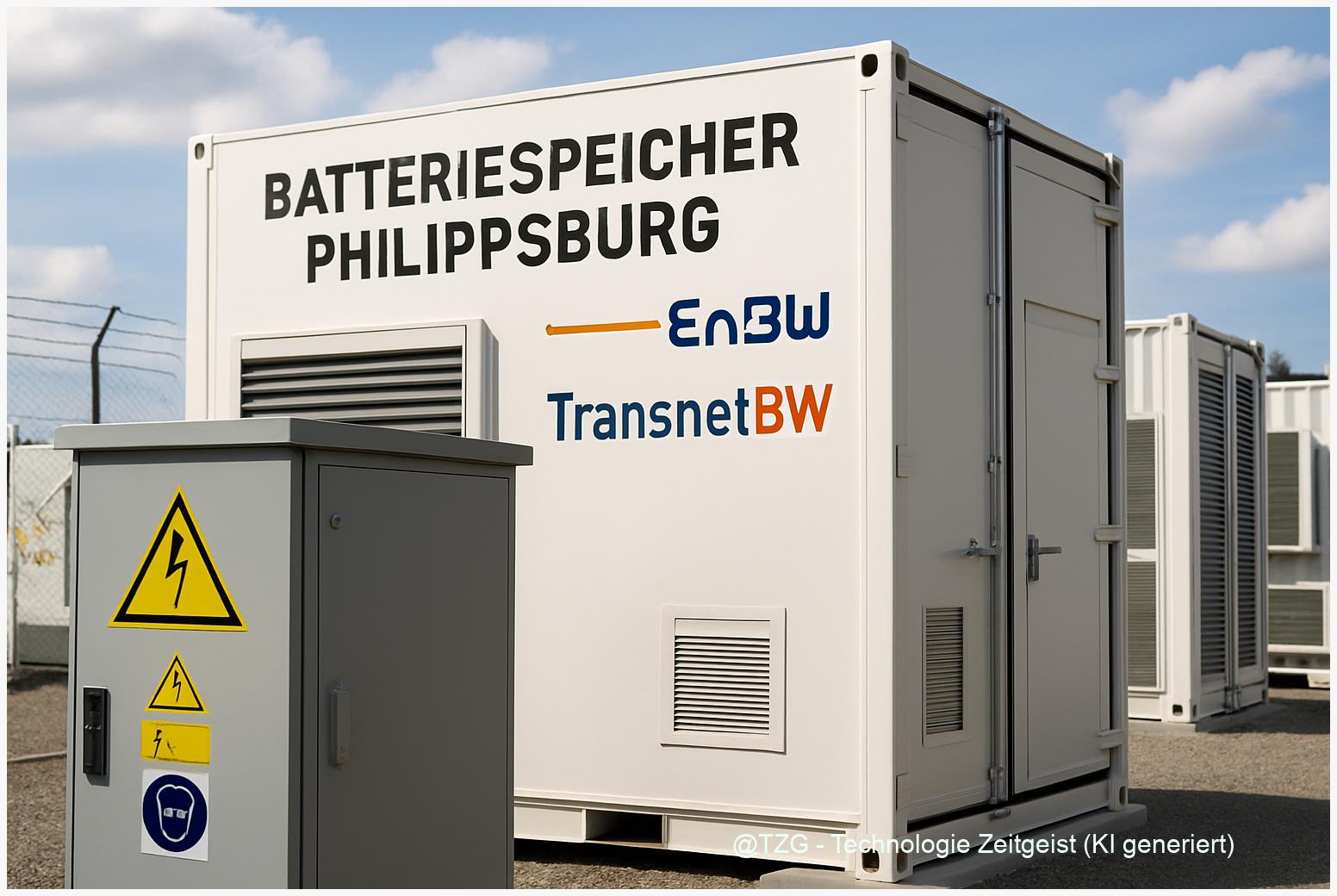



Schreibe einen Kommentar