Wed, 19 Feb 2025 09:00:00 +0200 – Brandenburgs Polizei will KI-gestützte Gesichtserkennung flächendeckend nutzen. Welche Chancen das bringt, aber auch welche Risiken und ethischen Fragen es aufwirft, erklären wir im Detail. Was steckt hinter dem Projekt, wie läuft die Technik, wer profitiert – und was bedeutet es für Bürgerrechte?
Inhaltsübersicht
EinleitungHintergrund und offizielle Beschlüsse
Organisation, Abläufe und Technik
Zukunftspläne und Einflussfaktoren
Folgen, Debatten und mögliche Fehler
Fazit
Einleitung
Brandenburg hat den Startschuss gegeben: Die Polizei setzt künftig verstärkt auf künstliche Intelligenz, um Verdächtige anhand von Gesichtsbildern zu identifizieren. Offiziell begründet wird das mit der Bekämpfung schwerer Kriminalität und grenznaher Verfolgung. Kritiker warnen jedoch vor einem gefährlichen Präzedenzfall in puncto Datenschutz und Bürgerrechte. Um zu verstehen, welche Folgen dieser Beschluss haben kann, lohnt ein genauer Blick auf die Entscheidungswege, die eingesetzten Technologien, die geplanten Erweiterungen – und vor allem auf die Frage, wer über Recht und Kontrolle wacht. Dieser Artikel beleuchtet systematisch die Hintergründe, die ökonomischen Interessen und die möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft.Hintergrund und offizielle Beschlüsse: Brandenburgs Polizei testet KI-Gesichtserkennung im Pilotmodus
Brandenburg rückt mit der KI Gesichtserkennung in den Fokus der deutschen Überwachungstechnologie-Debatte. Ein konkreter, landesweit angelegter Beschluss oder ein offiziell benanntes Großprojekt ist bislang nicht verabschiedet. Stattdessen testet die Polizei Brandenburg seit 2024 punktuell eine aus Sachsen stammende Lösung, meist als “PerlS” (Personen-Identifikation-System) bezeichnet. Das System prüft in Einzelfällen, ob Bilder von Überwachungskameras mit bestehenden polizeilichen Datenbanken abgeglichen werden können. Ein flächendeckender Rollout oder ein klar definiertes, öffentlich dokumentiertes Budget existiert laut aktuellen Primärquellen nicht Brandenburg setzt das System bislang nur auf Einzelfallbasis und mit richterlicher Genehmigung ein
, RBB.
Hintergrund für die beschleunigte Einführung ist der politische Druck nach spektakulären Eigentumsdelikten und eine verstärkte Diskussion über digitale Polizeiarbeit. Die Datenschutz Debatte flammt angesichts der neuen EU-KI-Verordnung (gültig ab 2024-08-01) und ungeklärter Rechtsgrundlagen erneut auf. Datenschützer und Landtagsfraktionen kritisieren, dass keine transparenten Beschlüsse im Landtag dokumentiert sind und die operative Anwendung auf rechtlich unsicherem Terrain erfolgt Landtagsprotokolle oder eindeutige politische Beschlüsse liegen nicht öffentlich vor
, Tagesspiegel.
Technische Basis und Status quo
Die Polizei Brandenburg nutzt für die KI Gesichtserkennung aktuell bestehende Kameranetzwerke an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen. Die zu analysierenden Bilder werden mit Referenzdaten aus polizeilichen Fahndungsdatenbanken abgeglichen. Brandenburg setzt nicht auf Palantir Gotham – dieses System wird nur in anderen Bundesländern erprobt. Genaue Angaben zu Hersteller, Systemarchitektur, messbaren Genauigkeits- oder Fehlalarmraten fehlen. Fachberichte und Medien bestätigen, dass die Lösung als Pilot läuft, ohne belastbare Erfolgskennzahlen Messwerte zu Fehlalarmen oder Systempräzision werden nicht veröffentlicht
, MAZ.
Rechtlich beruft sich die Polizei auf das brandenburgische Polizeigesetz sowie auf die neue EU-KI-Verordnung. Deren konkrete Ausgestaltung auf Landesebene bleibt allerdings umstritten. Kritiker fordern transparente Datenschutz-Folgenabschätzungen und unabhängige Überprüfung. Ein klarer Rahmen, wie in anderen Bundesländern, fehlt bislang Rechtsgrundlagen und Datenschutzdienstliche Prüfungen sind unvollständig
, Dr. Datenschutz.
Mit diesen Umrissen startet Brandenburgs Polizei einen offensiven, aber noch rechtlich und technisch unsicheren Kurs. Nächster Schritt ist die Analyse, wie Organisation und Technik im Alltag zusammenspielen – ein Blick ins Kapitel Organisation, Abläufe und Technik.
Organisation, Abläufe und Technik: Wie Brandenburg KI-Gesichtserkennung steuert und kontrolliert
Die KI Gesichtserkennung prägt den Alltag der Polizei Brandenburg – aber wie funktionieren Entscheidungsabläufe, Zugriffsrechte und technische Kontrolle wirklich? Wer darf den Einsatz autorisieren, welche Kontrollmechanismen schützen die Bürgerrechte und wie robust ist die Technik gegen Fehler oder Missbrauch?
Entscheidungs- und Betriebsabläufe: Wer entscheidet, wer kontrolliert?
Der Einsatz von KI Gesichtserkennung erfolgt in Brandenburg auf Basis polizeilicher Aufgabenstellung, vor allem zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität. Einsatzszenarien müssen laut aktuellen Berichten von der zuständigen Polizeiführung und zum Teil mit richterlicher Zustimmung genehmigt werden. Die Zugriffsrechte auf das System liegen bei spezialisierten Ermittlern. Die Dokumentation der Rechtevergabe und sämtliche Systemzugriffe werden protokolliert. Sichtkontrollen durch menschliche Experten bleiben vorgeschrieben: Verdachtsfälle, die das System meldet, prüft immer ein Polizeibeamter nach. Beschwerden, Auskunfts- und Löschanträge können Bürger über etablierte Kanäle einreichen. Die Landesdatenschutzbeauftragte prüft stichprobenartig den Ablauf und hinterfragt die Datensparsamkeit Die Brandenburger Datenschutzaufsicht fordert strikte Protokollierung und nachvollziehbare Governance
, RBB24.
Technische Architektur und Validierung
Im Einsatz sind fest installierte oder mobile Kameras, die Bilddaten in Echtzeit mit polizeilichen Datenbanken abgleichen. Details zur Software – etwa der Algorithmustyp oder genaue Hersteller – sind nicht öffentlich dokumentiert, da Brandenburg ein externes System aus Sachsen nutzt. Die Trainingsdaten basieren laut Fachpresse auf bestehenden polizeilichen Bildarchiven; eine genaue Verteilung nach Ethnien, Alter oder Geschlecht ist nicht transparent publiziert. Die Fehlalarmquote (False-Positive-Rate) wird von Datenschützern als kritischer Schwachpunkt benannt, da dazu keine offiziellen Zahlen vorliegen. Internationale Studien legen nahe, dass solche Systeme zu messbaren Diskriminierungseffekten neigen, insbesondere bei Minderheiten Verlässliche Validierungsdaten fehlen, was die Datenschutz Debatte weiter anheizt
, ZEIT.
Kontrollmechanismen und Sicherheit
- Alle Systemzugriffe und Analysen werden protokolliert
- Ein “Human-in-the-Loop” prüft verdächtige Treffer nach
- Der Landesdatenschutzbeauftragte kann Beschwerden prüfen und Audits verlangen
- Informationspflichten gemäß DSGVO: Betroffene erfahren ihre Rechte und Beschwerdewege
Datensicherheit verlangt laut Experten regelmäßige Penetrationstests und Updates. Details zu API-Schnittstellen oder konkreten Audit-Ergebnissen fehlen – das bemängeln sowohl Datenschützer als auch Technikjournalisten Brandenburgs Polizei verweist auf bestehende Informationspflichten, aber technische Offenlegung bleibt lückenhaft
, Polizei Brandenburg.
Kurzum: Die Überwachungstechnologie der Polizei Brandenburg setzt auf menschliche Kontrolle und externe Prüfungen. Doch fehlende Validierungsdaten und technische Transparenz befeuern die Datenschutz Debatte. Im nächsten Kapitel stehen die Zukunftspläne und Einflussfaktoren im Fokus.
Zukunftspläne und Einflussfaktoren: Brandenburgs Weg zur KI-Gesichtserkennung bleibt vage – und umstritten
Die KI Gesichtserkennung bleibt in Brandenburg ein strategisches Modernisierungsprojekt – doch klare Roadmaps oder öffentlich zugängliche Ausschreibungen fehlen weiterhin. Die Polizei Brandenburg signalisiert Offenheit für eine Ausweitung der Überwachungstechnologie, will aber ihre Maßnahmen erst nach grundlegenden Gesetzesreformen und Datenschutzprüfungen skalieren Eine konkrete, öffentlich machbare Roadmap liegt bislang nicht vor – politische Diskussionen zu Polizeigesetzen laufen bis 2027
, MAZ Online.
Meilensteine, Skalierungspläne und Abhängigkeitsrisiken
Bis 2027 prüft die Polizei Brandenburg die Ausweitung der KI Gesichtserkennung auf weitere Standorte und plant Schnittstellen zur Bundespolizei sowie zu Nachbarländern. Konkrete Zeitpläne und Standorte sind nicht veröffentlicht. Die Kosten für Software, Infrastruktur und Personalmodernisierung werden als signifikant eingeschätzt, aber bislang nicht detailliert ausgewiesen. Das birgt Abhängigkeitsrisiken gegenüber einzelnen Anbietern, da keine öffentlich dokumentierten Kriterien zur Anbieterwahl existieren Transparente Ausschreibungen, Anbieterlisten oder Evaluierungskriterien sind in Brandenburg bislang nicht öffentlich nachvollziehbar
, Dr. Datenschutz.
Mögliche Alternativen und Erfolgskriterien
- Diskutierte Alternativen: Anonymisierung von Bilddaten, Einsatzbegrenzungen auf spezifische Delikte und technische Zutrittskontrollen
- Erfolgskriterien: Zahl der identifizierten Straftäter, Reaktionszeit bei Fahndungen, Reduktion von Fehlalarmen, Akzeptanz bei der Bevölkerung
Politische und ökonomische Interessen spielen stark mit: Beratungsfirmen und Softwareanbieter (teils aus dem Sicherheitsumfeld Sachsens oder internationale Tech-Konzerne) hoffen auf Aufträge. Gewerkschaften fordern bessere IT-Ausstattung, Datenschützer drängen auf Transparenz. Hinweise auf personelle Interessenkonflikte oder undurchsichtige Vergabe lassen sich aus öffentlichen Quellen nicht klar belegen Die Gewerkschaft der Polizei mahnt Modernisierung an, fordert aber klare Regeln und öffentliche Kontrolle
, GdP Brandenburg.
Der nächste große Streitpunkt bleibt die gesellschaftliche Abwägung: Wie wirken sich neue Überwachungstechnologien auf Bürgerrechte und Vertrauen aus? Die Datenschutz Debatte dürfte in Brandenburg weiter an Schärfe gewinnen. Im folgenden Abschnitt stehen deshalb die Folgen, Debatten und mögliche Fehler im Mittelpunkt.
Folgen, Debatten und mögliche Fehler: Bürgerrechte unter Druck durch KI-Gesichtserkennung
Der Einsatz der KI Gesichtserkennung durch die Polizei Brandenburg setzt eine hitzige Datenschutz Debatte in Gang. Kritiker warnen vor weitreichenden Folgen für Bürgerrechte und psychologischen Effekten: Der Gedanke, jederzeit auf öffentlichen Plätzen von einer Überwachungstechnologie erfasst zu werden, beeinflusst das Verhalten und könnte das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit faktisch einschränken Menschen reagieren messbar zurückhaltender in überwachten Arealen
, Institut für Menschenrechte.
Ethische Dilemmata und internationale Erfahrungen
Die Landesdatenschutzbeauftragte mahnt: Ohne genaue Regeln drohen Fehlerkennungen, etwa durch demografische Verzerrungen in Trainingsdaten. Studien und Präzedenzfälle aus Großbritannien und den USA zeigen wiederholt, dass KI Gesichtserkennung systematisch People of Color oder Frauen benachteiligt – mit gravierenden Folgen wie ungerechtfertigten Polizeikontrollen Fälle von Fehlidentifikationen in den USA führten zu Festnahmen Unschuldiger
, Süddeutsche Zeitung. NGOs wie Digitalcourage und Amnesty International fordern deshalb einen raschen Stopp für flächendeckende biometrische Überwachung. Die EU-KI-Verordnung verlangt künftig striktere Folgenabschätzungen und zeitlich befristete Einsatzregeln für Systeme mit hohem Diskriminierungsrisiko.
Indikatoren für Scheitern und sinnvolle Alternativen
- Zunahme falsch identifizierter Personen, dokumentiert durch Beschwerden oder Medienfälle
- Repräsentative Umfragen mit Vertrauensverlust in die Polizei Brandenburg
- Gerichtliche Verbote oder harte Einschränkungen der Überwachungstechnologie
- Unerwartet hohe Folgekosten für Wartung, Anpassung, Rechtsberatung
Rückblickend könnten Alternativen wie gezielte Ermittlungen, Analyse anonymisierter Bewegungsdaten oder eine klare Begrenzung auf schwere Straftaten als klüger gelten. Fachleute empfehlen daher: klare Rechtsgrundlagen, transparente Algorithmen, unabhängige Wirkungskontrolle – und eine offene Debatte darüber, wie viel Bürgerrechte Brandenburg für mehr Sicherheit preisgeben will. Im Gesamtbild bleibt der Streit um die KI Gesichtserkennung ein Gradmesser für die Balance zwischen Innovation und Freiheit in der öffentlichen Sicherheit.
Fazit
Die Polizei Brandenburg will Vorreiter sein, wenn es um künstliche Intelligenz im Sicherheitsbereich geht. Doch was als technischer Fortschritt verkauft wird, könnte sich zu einer gesellschaftlichen Zerreißprobe entwickeln. Erfolgreich wird das Projekt nur sein, wenn Transparenz, rechtsstaatliche Kontrolle und unabhängige Überprüfung fest verankert sind. Entscheidend bleibt daher, wie politisch Verantwortliche in den kommenden Jahren mit Kritik umgehen – ob sie Kurs halten, lenken oder einen klaren Schnitt machen. Die Debatte ist damit nicht abgeschlossen, sondern steht erst am Anfang.Diskutieren Sie mit: Soll die Polizei Brandenburg KI zur Gesichtserkennung nutzen? Teilen Sie diesen Artikel und Ihre Meinung!
Quellen
Einsatz von Gesichtserkennung in BrandenburgKritik an Polizei-System zur Gesichtserkennung
Polizei Brandenburg plant mehr KI-Einsatz – Gesichtserkennung im Gespräch
Einsatz von Gesichtserkennung in Brandenburg
Gesichtserkennung: Heimlich gefilmt. Von der Polizei
Datenschutzkritik Brandenburger Datenschützer – Kritik an Polizei-System zur Gesichtserkennung
Informationspflichten Verträge | Polizei Brandenburg
Polizei Brandenburg plant mehr KI-Einsatz – Gesichtserkennung im Gespräch
Einsatz von Gesichtserkennung in Brandenburg
GdP Brandenburg – Digitalisierung und IT-Modernisierung
Institut für Menschenrechte – Warnung vor Risiken automatisierter Gesichtserkennung
Datenschutzaufsicht – Kritik an Polizei-System zur Gesichtserkennung
Einsatz von Gesichtserkennung in Brandenburg
Kritik an Software-Gesichtserkennung – Brandenburger Innenpolitik
Hinweis: Für diesen Beitrag wurden KI-gestützte Recherche- und Editortools sowie aktuelle Webquellen genutzt. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand: 8/27/2025


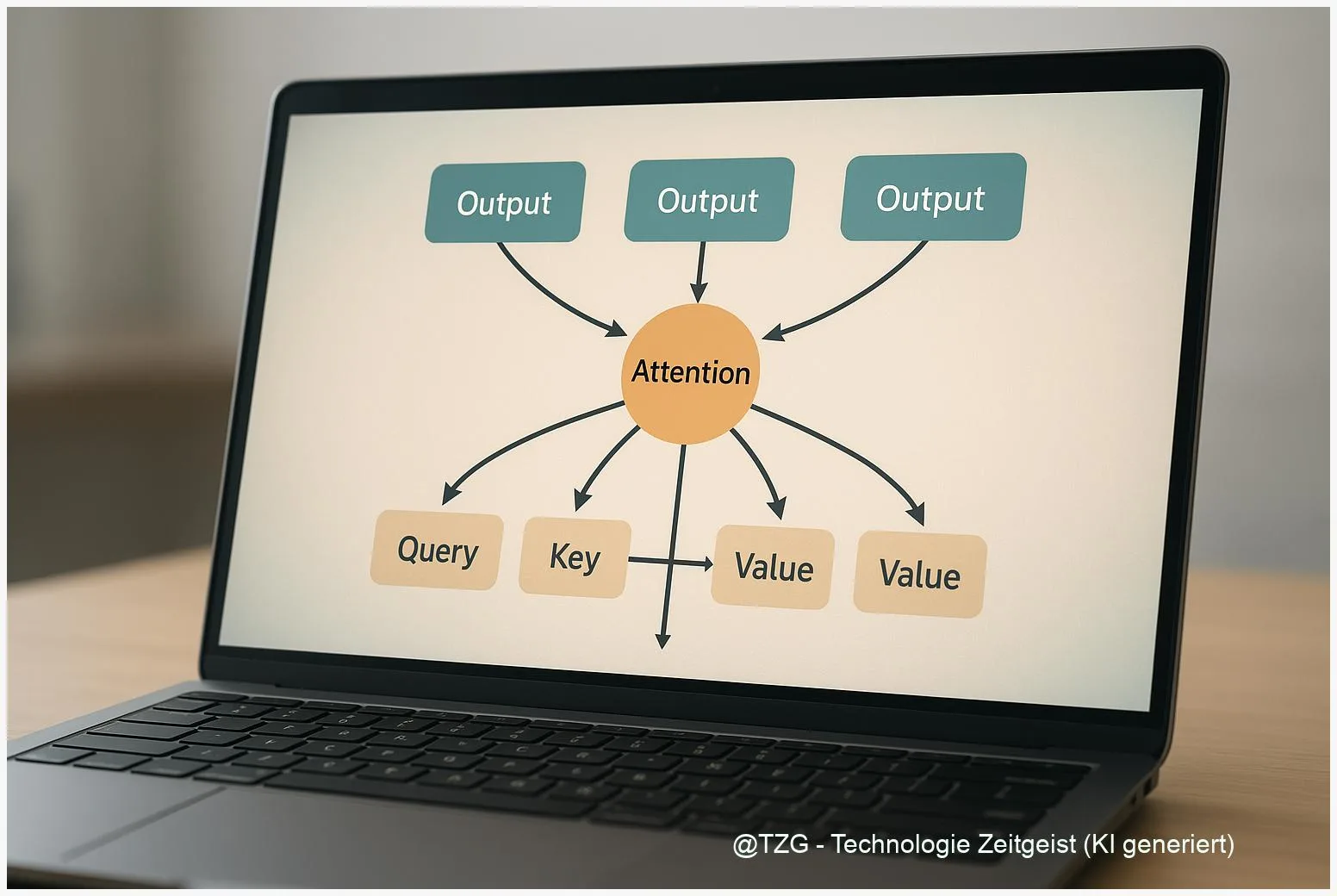



Schreibe einen Kommentar