Kurzfassung
BASF, Porsche und der Technologiepartner BEST präsentieren ein Projekt, das Altfahrzeugreste per Gasifizierung in neue Kunststoffbausteine überführt. Das Herzstück: chemisches Recycling, das heterogene Shredder-Mischfraktionen in Syngas verwandelt und über den BASF‑Verbund in hochwertige Komponenten zurückführt – etwa für Lenkrad‑Schaum. Der Ansatz nutzt Massenbilanz und setzt auf zirkuläre Rohstoffe statt fossiler Quellen. Was ist neu, was ist nachweisbar, und wo liegen die Grenzen? Unser Überblick ordnet den Meilenstein ein und zeigt, was jetzt folgen muss.
Einleitung
Alte Autos landen im Schredder – übrig bleibt ein schwer zu recycelnder Mix. Genau hier setzt ein neues Gemeinschaftsprojekt von BASF, Porsche und BEST an. Ziel: Aus Reststoffen wieder hochwertige Kunststoffe machen, die in Neuwagen verbaut werden. Der Weg führt über Gasifizierung und weiterverarbeitete Rohgase, die in den BASF‑Verbund fließen. Chemisches Recycling wird damit greifbar – nicht nur als Studie, sondern als demonstrierter Praxistest. Was dahinter steckt, welche Belege es gibt und welche Hürden bleiben, klären wir in diesem Überblick.
Von Altteilen zu Neuteilen: So funktioniert es
Im Kern wird eine wilde Mischung aus Altfahrzeugresten – die sogenannte Shredderleichtfraktion (englisch: ASR) – zusammen mit Biomasse in einer Hochtemperatur‑Anlage vergast. Dabei entstehen Energieträger wie Synthesegas, die als chemische Bausteine dienen. Im BASF‑Verbund werden diese in Vorprodukte für Kunststoffe überführt. Über einen Massenbilanzansatz lässt sich der zirkuläre Anteil ausgewählten Endprodukten zuordnen, zum Beispiel Polyurethan‑Schaum für Lenkräder.
“Aus gemischten Reststoffen wieder hochwertige Bauteile zu machen, ist der Knackpunkt für eine echte Kreislaufwirtschaft im Auto.”
Wichtig: Bei chemischem Recycling wird der Kunststoff nicht mechanisch gewaschen und geschmolzen. Stattdessen wird er in Molekül‑Bausteine zerlegt und neu aufgebaut. Das hilft bei verunreinigten oder gemischten Abfällen, die sich kaum sortenrein trennen lassen. Laut den Projektpartnern wurde der Ersatz fossiler Rohstoffe im Versuchsaufbau demonstriert und die Anwendung am Bauteilbeispiel gezeigt. Konkrete Durchsatz‑, Energie‑ oder Emissionswerte wurden in den Presseinformationen jedoch nicht ausgewiesen.
Typische Prozessschritte im Überblick:
| Schritt | Kurz erklärt | Beispiel |
|---|---|---|
| Gasifizierung | Zerlegung zu Synthesegas bei hoher Temperatur | ASR + Holzchips |
| Weiterverarbeitung | Aufbereitung im Chemie‑Verbund zu Vorprodukten | Polymer‑Bausteine |
| Massenbilanz | Zuweisung des zirkulären Anteils zu Bauteilen | Lenkrad‑Schaum |
Warum das Projekt für Autobauer wichtig ist
Autobauer müssen knappe Ressourcen sparen, Emissionen senken und strengere Regeln erfüllen. Besonders knifflig sind Kunststoffteile, die nach vielen Jahren Nutzung in komplexen Materialmixen vorliegen. Hier liefert das Projekt einen Aufschlag: Es zeigt, dass selbst schwierige Reststoffe wieder in hochwertige Anwendungen zurückgeführt werden können. Für Hersteller wie Porsche ist das ein Weg, Neuteile mit zirkulärem Anteil einzusetzen, ohne die gewohnte Qualität zu verlieren.
Auch auf Systemebene zählt der Ansatz. Wenn mehr Post‑Consumer‑Material in die Lieferkette zurückfließt, sinkt die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen. Gleichzeitig wächst die Planungssicherheit, weil Abfälle nicht nur als Kostenfaktor enden, sondern als Rohstoff neu gedacht werden. Chemisches Recycling kann dabei mechanische Verfahren ergänzen: Mechanik zuerst, wo möglich; chemische Wege für Problemfraktionen. So entsteht Schritt für Schritt eine Kreislaufwirtschaft im Auto.
Ein weiterer Baustein sind Standards und Zertifikate. Der Massenbilanzansatz erlaubt die Zuweisung zirkulärer Mengen in komplexen Anlagen. Unabhängige Zertifizierungen wie ISCC PLUS oder REDcert² schaffen hier Nachvollziehbarkeit. Für Einkaufsabteilungen wird damit greifbar, welcher Anteil an einem Bauteil rechnerisch aus zirkulären Quellen stammt. Das ist kein Selbstzweck, sondern erleichtert die Berichterstattung zu Nachhaltigkeit und hilft, künftige Vorgaben einzuhalten.
Aber klar ist auch: Ohne belastbare Zahlen zu Energiebedarf, Emissionen und Kosten bleibt der Sprung in die Breite riskant. Genau diese Daten müssen die Partner als Nächstes liefern, damit sich Unternehmen in größerem Maßstab festlegen können.
Transparenz, Massenbilanz & offene Fragen
Die Projektpartner betonen, dass im Demonstrationsaufbau fossile Rohstoffe ersetzt wurden und Bauteile mit zirkulärem Anteil realisiert wurden. Das ist ein starkes Signal – und doch bleiben wichtige Details offen. Es fehlen Angaben zu Inputmengen, Ausbeuten und Energie. Ohne diese Daten lässt sich die Klimabilanz nicht seriös vergleichen. Für die öffentliche Debatte ist das entscheidend, denn nur mit unabhängigen Lebenszyklusanalysen (LCA) wird klar, welchen Unterschied der Ansatz real bewirkt.
Die Massenbilanz ist dabei ein hilfreiches Werkzeug, aber kein Zaubertrick. Sie ordnet zirkuläre Rohstoffe rechnerisch zu, auch wenn sie sich im Prozessstrom vermischen. Das ermöglicht Skalierung in bestehenden Anlagen. Gleichzeitig braucht es saubere Audits und klare Kommunikation, damit aus Zuordnung kein Missverständnis wird. Verbraucher wollen wissen: Wie viel Zirkularität steckt wirklich im Teil in meiner Hand?
Transparenz heißt auch, Kritikpunkte ernst zu nehmen. Gasifizierung kann energieintensiv sein. Herkunft des Stroms und der Prozesswärme beeinflussen die Emissionen stark. Zudem müssen Logistikketten für Altfahrzeuge verbessert werden, damit genug geeigneter Input ankommt. Eine ehrliche Roadmap mit Meilensteinen – Datenrelease, Zertifizierung, Skalierungsschritte – schafft Vertrauen und zieht weitere Industriepartner an.
Kurz: Der technische Beweis ist erbracht, die Beweisführung für Wirkung und Wirtschaftlichkeit steht noch aus. Genau hier entscheidet sich, ob aus einem Leuchtturmprojekt eine belastbare Industrie‑Lösung wird.
Skalierung: Von der Pilotstrecke zur Serie
Wie geht es weiter? Aus Pilotmaßstab muss nun ein robuster, wirtschaftlicher Betrieb werden. Dazu gehören klare Kennzahlen: Durchsatz pro Jahr, Energiebedarf pro Tonne Input, Ausbeute in verwertbare Vorprodukte und die daraus resultierende CO₂‑Bilanz. Ohne diese Werte bleibt die Entscheidung für Investitionen schwer. Die Partner sind am Zug, diese Metriken zu liefern – idealerweise durch unabhängige Prüfungen.
Parallel braucht es verlässliche Rohstoffströme. Altfahrzeugreste sind heterogen. Vordemontage, smarte Sortierung und definierte Qualitätsfenster machen den Prozess stabiler. Kooperationen mit Verwertern und Kommunen können helfen, die nötigen Mengen zu sichern. Logistik wird zum Dreh‑ und Angelpunkt: kurze Wege, planbare Lieferungen, transparente Qualität.
Auf der Marktseite entscheidet die Abnahme. Hersteller brauchen Produkte, die technisch gleichwertig sind – und preislich planbar. Hier spielt der Massenbilanzansatz seine Stärke aus: Er erlaubt den Einsatz zirkulärer Rohstoffe in bestehenden Großanlagen, ohne jedes Produkt getrennt zu führen. Wenn die Zertifizierung steht und die Datenlage stimmt, können Einkäufer verlässlich buchen und berichten.
Am Ende zählt der Mix: Mechanisches Recycling, wo es sauber funktioniert; chemische Wege für schwierige Fraktionen; erneuerbare Energie für energieintensive Schritte. Gelingt dieser Mix, wird aus dem Projekt mehr als eine Schlagzeile – es wird Teil der täglichen Praxis in der Autoindustrie.
Fazit
Das Projekt von BASF, Porsche und BEST macht vor, wie aus Altfahrzeugresten wieder einsatzfähige Kunststoffbausteine werden. Chemisches Recycling ergänzt mechanische Verfahren und öffnet Türen für problematische Mischfraktionen. Der technische Proof‑of‑Concept ist da; nun zählen Daten zu Klima‑ und Kostenvorteilen. Mit Transparenz, Zertifizierung und verlässlichen Rohstoffströmen kann daraus ein veritabler Baustein der Kreislaufwirtschaft im Auto werden.
Diskutiert mit: Was braucht es für den Durchbruch – bessere Daten, klare Regeln oder mutige Einkäufe? Teilt den Beitrag mit eurer Community!

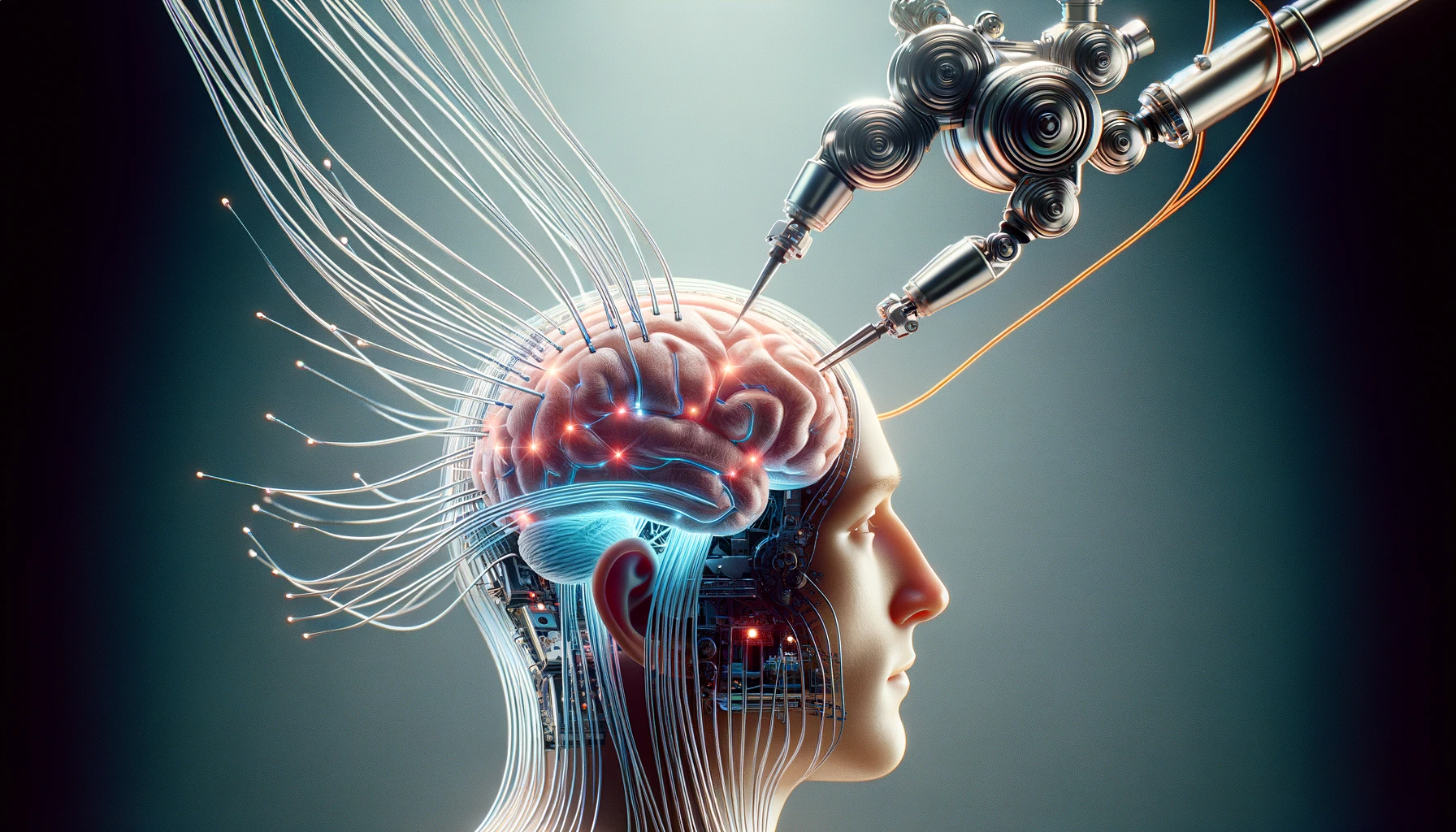


Schreibe einen Kommentar